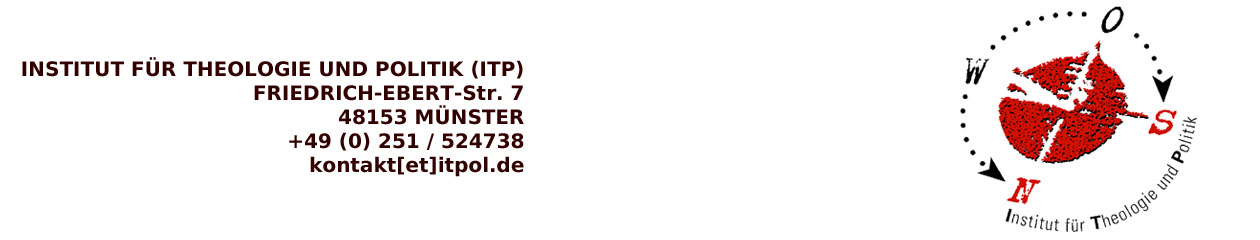Erinnern wir uns: 2011 begann der sogenannte „arabische Frühling“. Millionen Menschen gingen auf die Straße, versammelten und organisierten sich und machten das Unmögliche möglich: Sie stürzten die autoritären Regierungen in Tunesien, Libyen, Ägypten … und die Dynamik ergriff auch viele Menschen in Syrien. Wie stark diese Aufbrüche begrenzt waren, ja, in welches Drama sie vielfach führten, ist heute leider unschwer zu erkennen. Es kommt sogar angesichts der Kämpfe in Syrien die Frage vieler Aktivist_innen auf, ob man vielleicht besser nie den Aufstand begonnen hätte …
Im vorliegenden Beitrag, der während der Arbeiten am Erinnerungsprojekt „Zeichen der Zeit“ 2013 entstanden ist, setzt sich Julia Lis mit der Bedeutung der vielen Aufbrüche von 2011 und den Herausforderungen für „uns Christ_innen“ auseinander. Heute muss sicherlich manches aus dem Beitrag aktualisiert werden. In diesem Sinne handelt es sich bei solchen Analysen auch immer um „Work in Progress“.
In den nächsten Wochen werden wir auf www.itpol.de einige Beiträge unseres Werkbuchs “Anders Mensch sein in einer anderen Kirche…”. Dokumentation und Weiterführung der Konziliaren Versammlung Frankfurt 2012, Münster 2014 zur weiteren Diskussion veröffentlichen. Die Beiträge können auch als pdf in unserem Digitalladen kostenlos runtergeladen werden.
Aufruhr und Aufbruch – Zeichen der Zeit*
von Julia Lis
Seit im Winter 2011 der Aufruf zur Konziliaren Versammlung erschien, hat sich viel verändert, ist die Welt, in der wir leben, in Teilen wieder eine andere geworden. Wenn wir nun, fast zwei Jahre später, fragen wollen, wie es weitergehen kann, mit dem, was auf der Konziliaren Versammlung begonnen hat, einem gemeinsamen Prozess, in dem wir die Zeichen der Zeit erkennen und gemeinsam für die Würde aller Menschen eintreten wollen, müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen, in welcher Welt wir heute leben und wo und wie in ihr konkrete Kämpfe um ein Leben in Fülle für alle Menschen stattfinden und sichtbar werden können.
Hoffnungsvolle Aufbrüche und gescheiterte Revolutionen
So hieß es damals im Aufruf: „Voller Hoffnung sehen wir in der Welt, wie in Nordafrika Menschen aufstehen gegen autoritäre Regime und Machthaber, so dass ganze Völker sich zu Akteuren ihrer Geschichte erheben und ihr Recht auf Demokratie und Würde einfordern.“
Seit damals haben wir erlebt, wie sich an manchen Orten diese Hoffnung in Entsetzen gewandelt hat: Libyen wird weithin von Milizen beherrscht, in Ägypten werden von der neuen Militärregierung Proteste mindestens genauso blutig niedergeschlagen wie unter Mubarak und Syrien bietet das wohl traurigste Beispiel eines von Jahren von Krieg und Gewalt so verwüsteten Landes, das hier der Aufbau einer neuen, gerechten Gesellschaft in weite Ferne gerückt zu sein scheint. So mischt sich in die Erinnerung an hoffnungsvolle Frühlingstage ein schaler Beigeschmack: War denn etwa alles umsonst, war das Hoffen auf eine tief greifende Veränderung vergeblich? Haben wir etwa „aufs falsche Pferd“ gesetzt? Haben wir doch zu viel erwartet, die Schwierigkeiten, die ein wirklicher Veränderungsprozess bereitet, unterschätzt? Diese Fragen sind nicht neu, sie begleiten seit jeher die Geschichte der Niederlagen im Kampf um Befreiung und Gerechtigkeit.
Sie einfach zu bejahen und sich resigniert abzuwenden, würde bedeuten die Kraft dieser Aufstände und die Hoffnung, die sich aus ihnen speist, allein nach ihrem Erfolg zu beurteilen. Auch und gerade dort, wo Bewegungen und Aufstände nicht zur nachhaltigen, dauerhaften gesellschaftlichen Veränderung führen, können sie doch bleibende Bedeutung erlangen. Sie werden zur Erinnerungsorten daran, was die Hoffnung und der Aufbruch Vieler vermögen und gerade dadurch zu bleibenden Ereignissen, die Geschichte machen. Die biblischen Geschichten sprechen immer wieder von solchen hoffnungsvollen Aufbrüchen und ihrem Scheiterns: „Wir aber hatten gehofft“(Lk 24,21) – so sagen die Jünger auf dem Weg nach Emmaus im Bewusstsein, dass der Messias tot und die Möglichkeit einer Befreiung in weite Ferne gerückt ist – und begegnen dem Auferstandenen…
Aus der Erinnerung an einen jeden Aufbruch, der den Keim umfassender Veränderung in sich trug, erwächst neue Hoffnung, dass Befreiung bleibend möglich ist, einer Welt zum Trotz in der „Befreiung die Ausnahme, Unterdrückung die Regel ist“1. So kann auch der Arabische Frühling zu einem Gedächtnisort werden, der eine solche Hoffnung bezeugt: Was der Arabische Frühling nämlich, bei allem Scheitern, bleibend uns allen ins Gedächtnis gerufen hat, ist, dass die Welt nicht immer bleibt, wie sie ist, dass auch diktatorische Regime, die mit Brutalität regieren, gestürzt werden können, dass mit dem Unvorhersehbaren in der Geschichte jederzeit zu rechnen ist und dass die Massen der Menschen, sobald sie sich in Bewegung setzen, ihre Empörung über Unrecht und Unterdrückung zum Ausdruck bringen und über alle Unterschiede hinweg solidarisch zusammengehen, zu einem Machtfaktor werden, der nicht mehr übersehen werden kann. Der Arabische Frühling, so kann man vielleicht sagen, hat uns daran erinnert, dass es nicht nur die Herrschenden sind, die Weltgeschichte schreiben, sondern dass wir alle zu Subjekten der Geschichte werden können, sobald wir uns unsere kollektiven Macht bewusst werden und gemeinsam aufstehen, um für ein Leben in Würde für uns alle zu kämpfen. So ist und bleibt der Arabische Frühling ein Ereignis, dessen Folgen und Bedeutung wir noch kaum abschätzen können. So wird man mit dem französischen Philosophen Alain Badiou gesprochen, den Arabischen Frühling als einen „geschichtlichen Aufstand“ bezeichnen können, der mehr ist als eine bloße Revolte, weil er beginnt, gemeinsamen Forderungen Ausdruck zu verleihen.2
Lokale Bewegungen und globale Proteste
Auf den Arabischen Frühling folgten weitere Aufbrüche und Proteste, auch in Regionen der Welt, wo man sie nicht vermutet hätte. Nicht alle könnte man als geschichtliche Aufstände bezeichnen, viele waren eher „unmittelbare Aufstände“3 in dem Sinne, dass sich hier Wut und Empörung über das in den gesellschaftlichen Strukturen verankerte Unrecht spontan entluden, ohne das daraus eine gemeinsame Organisierung wurde oder Forderungen und Ideen in den Mittelpunkt rückten, die die momentane lokale Situation überschritten hätten. Doch Aufruhr und Protest ebbten nicht ab und würden zu einer Konstante, die es erschwerte, die herrschende Ordnung als die beste der Möglichen zu legitimieren.
Die Proteste brachen nicht nur oder vor allem dort auf, wo man die Massen der in die Verelendung Getriebenen vermutet, auch dort, wo wie in der Türkei oder in Brasilien ein steigendes Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren die öffentliche Wahrnehmung prägte und man von einem Boom sprach, regte sich der Protest gegen die damit verbundene Politik, die sich nicht an den Bedürfnissen von Mensch und Natur ausrichtet, sondern nach den Zwängen des Marktes.
Die Frage, die diese Proteste mit sich bringen, ist die nach ihrer eigentlichen Agenda, nach ihrem eigentlichen Ziel: Geht es im Grunde nur um eine Reihe jeweils spezifisch gelagerter lokaler oder regionaler Probleme? Oder drückt sich hier etwas Umfassenderes, Grundsätzlicheres aus? Geht es nicht auch um ein oft kaum zu artikulierendes Unbehagen mit einer globalen neoliberalen, kapitalistischen Weltordnung, die zur unhinterfragbaren Rahmenbedingung für politisches wie ökonomisches Handeln stilisiert wird? Kommt hier ein Schrei zum Ausdruck, der sich der Alternativlosigkeit des Bestehenden entgegenstellt und danach fragt, ob es nicht auch anders sein könnte, ob ein anderes Leben, eine andere Gesellschaft, ja eine andere Welt möglich wäre, auch wenn es für dieses „anders“ noch keine Sprache gibt, um es Näherhin zu bestimmen? In dieser Frage artikuliert sich auch die nach den Gemeinsamkeiten dieser vielen Kämpfe: Wenn es hier so unterschiedliche Forderungen gibt und sehr verschiedene Subjekte, (oft auch in Bündnissen, die man so einige Jahre zuvor noch nicht für möglich gehalten hätte, so etwa wenn wir daran denken, dass im Gezi-Park so unterschiedliche Gruppen wie Angehörige der urbanen Mittelschicht, Kommunist_innen, Sozialist_innen, Kurd_innen, Gewerkschaftsangehörige, Alevit_innen, Aktivist_innen aus der Lesben-, Schwulen- und Transgenderbewegung und Fußballultras zusammenkamen) an den Protesten beteiligt sind, wo lassen sich dann überhaupt Verbindungslinien herstellen? Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten: So ist auffällig, dass sich diese Proteste an lokalen oder regionalen Themen wie etwa in Brasilien die Frage der Fahrkartenpreise, in Istanbul der Abriss eines Parks und die Errichtung eines Einkaufszentrums oder der Protest gegen Korruption in der Ukraine entzünden.4 Und zugleich artikuliert sich in der generellen Forderung nach Demokratisierung, nach Freiheit, nach Selbstbestimmung und in der Wut über eine Politik der Herrschenden, die die breite Bevölkerung nicht im Blick hat, etwas, was über diese konkreten Probleme hinausgeht. Der Bezug auf diese Forderungen zeigt, dass es hier um mehr geht, als um die Verteidigung persönlicher Interessen oder der Interessen einer Gruppe, der man sich zugehörig fühlt. Denn die Forderung nach Demokratie, nach Freiheit, Gerechtigkeit impliziert, dass es diese Rechte nur für alle geben kann oder gar nicht. Somit weisen diese Forderungen über partikulare Kämpfe hinaus und nehmen das Gesamt in den Blick, hinterfragen die Rahmenbedingungen, unter denen Politik gemacht und verstanden wird. Wer solche Forderungen erhebt und dafür eintritt, kann vielleicht auch beginnen von den Wurzeln her, also im wörtlichen Sinn radikal, nach den Grundlagen der bestehenden Ordnung und der Möglichkeit ihrer Veränderung zu fragen.
Das Durchbrechen des Bestehenden beginnt mit dem Schrei des Protestes, der sich gegen all das richtet, was den Menschen ihre Würde zu nehmen versucht und einem Leben aller in Fülle entgegensteht. Dies ist ein erster Schritt, wenn wir zu einer wirklichen Veränderung kommen wollen. Er ist eine notwendige Voraussetzung und doch darf es beim Schrei allein nicht bleiben. Vielmehr muss er in einen Prozess münden, in einen gemeinsamen Weg vieler, die an der Entwicklung wirklicher Alternativen mitarbeiten wollen. Wie das gelingt, lokal wie international, und wie sich die vielen kleinen Prozesse und Aufbrüche miteinander verbinden und verknüpfen lassen, so dass aus und in ihnen ein gemeinsamer Weg der Befreiung erkennbar ist, genau das ist die Herausforderung, vor der wir heute stehen.
Zeichen der Zeit erkennen
Die Zeichen der Zeit, von denen das Zweite Vatikanische Konzil gesprochen hat, dürfen nicht einfach mit beliebigen Trends oder Modeerscheinungen verwechselt werden. Zeichen der Zeit ist vielmehr, was auf das Letzte der menschlichen Existenz zielt. Weil sich die Zeichen der Zeit also auf Fragen von Leben und Tod, von Sklaverei und Freiheit, von Gerechtigkeit und Unterdrückung beziehen, haben sie eine unterscheidende Funktion.
Diese unterscheidende Funktion braucht es, wenn sich Christ_innen innerhalb der globalen Wirklichkeit orientieren und positionieren wollen. So erscheint die Zersplitterung der Wirklichkeit eine Komplexität mit sich zu bringen, die manche mutlos kapitulieren lässt. Angesichts der Größe der Probleme, die nur noch von Expert_innen als je einzelne analysiert und begriffen werden können, erscheint es ein aussichtsloses Unterfangen, sich selbst über die Vorgänge in dieser Welt noch eine Meinung bilden zu können, Positionen zu beziehen. Eine jede solche Positionierung setzt sich dann der Gefahr aus, als platt oder vereinfachend wahrgenommen zu werden, ja gar als ideologisch, in dem Sinne, dass sie versuche Pluralität auszublenden und komplexe Zusammenhänge einseitig aufzulösen. Angesichts dieses Befundes erscheint der Versuch, etwas zu schreiben über die Aufbrüche weltweit geradezu anmaßend: Wer könnte sich schon äußern zu einer derart global und umfassend gestellten Frage? Ist nicht jedes Sprechen in so einem Zusammenhang gleich dem Vorwurf ausgesetzt, undifferenziert zu sein, Dinge auszublenden, in unzulässige Vereinfachungen zu verfallen? Diese Position wirkt in ihrem Eintreten für Differenzierungen und das Wahrnehmen von Komplexität zunächst einleuchtend. Ideologiekritisch ließe sich aber auch eine solcher Position daraufhin hinterfragen, inwieweit sie dazu beiträgt, das alles bleibt, wie es ist. Denn in der Praxis kommt sie oft einer Kapitulation vor einer als komplex empfundenen Welt gleich: Indem sie unterstellt eine Positionierung sei heute weder möglich noch wünschenswert, ermöglicht sie einen bequemen Rückzug in den engen Gesichtskreis der eigenen Probleme und Befindlichkeiten. Wo ich mich nicht positionieren kann, weil die Zusammenhänge zu komplex geworden sind, bin ich von der Pflicht eines unterscheidenden Blicks, vom Ringen um Urteile, die nach wahr und falsch unterscheiden, weitgehend entbunden. So zu denken, käme einer Kapitulation vor der modernen Welt gleich. Die Rede des Zweiten Vatikanischen Konzils vom Erkennen der Zeichen der Zeit, weist in eine andere Richtung. Sie verlangt den Christ_innen die Analyse der gegenwärtigen Wirklichkeit ab, auch dort, wo Komplexitäten und Widersprüche diese erschweren. Dies erfordert zum einen ein Mühen um möglichst genaue Analyse dessen, was in der Welt passiert. Es erfordert das Fragen nach Zusammenhängen und das Ringen um Wahrheit, im Wissen darum, dass einem solchen Ringen Fehlurteile und falsche Entscheidungen mit gravierenden historischen Konsequenzen nicht erspart bleiben. Dazu braucht es Kriterien, die das Urteilen in und trotz der Komplexitäten und Widersprüche ermöglichen. Die Rede des Konzils von der Priorität „der Armen und Bedrängten aller Art“ für das Erkennen der Zeichen der Zeit verweist auf die Perspektive der Armen, der Schwachen, der Leidenden als so ein wesentliches Kriterium, um die Zeichen der Zeit mitten in der Welt von heute zu sein zu erkennen. So ist es zum Beispiel nicht nötig, Expertin für Wirtschafts- oder Finanzmarktpolitik, so muss man auch nicht notwendigerweise die Finanz- und Schuldenkrise in allen Details zu verstehen, um zu begreifen, dass die Austeritätspolitik, die in Südeuropa für eine Verarmung breiter Teile der Bevölkerung sorgt, nicht richtig sein kann.
Position beziehen in Zeiten undurchschaubarer Konflikte
Genauso wahr ist allerdings: Viele der Konflikte, denen wir momentan begegnen, erscheinen weniger durchschaubar: Es geht in der internationalen Solidaritätsarbeit heute weniger um Befreiungsbewegungen, die sich deutlich politisch positionieren, und eine Alternative etwa zu Militärdiktaturen darstellen, wie dies in Lateinamerika in den 70er und 80er Jahren der Fall war. Die Bewegungen der letzten Zeit vom Arabischen Frühling bis zur Ukraine wirken da wesentlich difuser: Das Moment des Aufstands gegen Zustände, die als ungerecht und unmenschlich empfunden werden, bedeutet noch nicht notwendig, dass dieser Aufstand auch in einen Prozess mündet, der die Perspektive einer Befreiung aller zu entwickeln sucht. Die Vielfalt und Heterogenität der Subjekte bedeutet nicht nur die Chance mehr Menschen miteinzubeziehen und unterschiedliche Perspektiven zu vereinen. Sie bringt auch Probleme mit sich, da hier oft verschiedene Interessen nebeneinander stehen und so das Entwickeln gemeinsamer Prozesse erschwert wird. So zeigt sich etwa momentan in Griechenland, dass es zwar viel Protest gibt, etwa in Form von gewerkchaftlicher Organisierung und Streiks. Da diese jedoch nicht gemeinsam geführt werden, sondern jede Berufs- und Interessengruppe einzeln und für sich streikt, fällt es den Herrschenden leicht, die isolierten Gruppen ruhigzustellen und so wird ein massiver, gemeinsamer Aufbruch, der auch von den Herrschenden nicht mehr übersehen werden kann, weitgehend verhindert.
Noch dramatischer wird die Situation, wenn, wie es sich in der Ukraine nun gezeigt hat, der Aufstand von faschistischen Kräften vereinnahmt wird. Wo ein Machtvakuum entsteht und ein Organisierungsprozess von unten nicht gelingt, können sich dann diejenigen durchsetzen, die einfache Botschaften zu bieten haben, aber auch die Stärke, ihre Interessen nicht nur zur Sprache zu bringen, sondern auch durchzusetzen. Das wird insbesondere dort möglich, wo linke Alternativen schwach und, wie in der Ukraine, durch die Geschichte stark kompromittiert sind.
Am Beispiel der Ukraine zeigt sich aber auch, dass eine Positionierung nach analytischer Differenzierung verlangt und eben kein Schwarz-Weiß denken meinen kann: Sich auf der Seite derer zu positionieren, die auf dem Maidan gegen Korruption und die soziale Lage im Land aufbegehrten, kann nicht meinen, die Augen davor zu verschließen, wie ihr Protest nach zwei Seiten hin vereinnahmt wurde: Zum einen durch reaktionäre und faschistische Kräfte im Land, zum anderen durch die Europäische Union, deren politische Vertreter hier eine willkommene Gelegenheit erblickten, ihre Interessens- und Einflusssphäre zu erweitern und der Ukraine einen Sparkurs nach griechischem Modell verordneten. Genauso fatal wäre es aber diese Sichtweise einfach umzukehren. Es gilt anzuerkennnen, dass es auch in der Bewegung des Anti-Maidan Elemente des Aufstands gegen Ungerechtigkeit und Korruption gab, nicht lediglich eine von Russland gesteuerte Anschlussbewegung. Und zugleich kann man sich nicht auf die Seite Russland schlagen und übersehen wie auch hier und nicht nur von der EU imperiale Großmachtinteressen verfolgt werden.
Internationale Solidarität vor neuen Herausforderungen
Die Ambivalenz von Positionierungen, die Tatsache, dass die Widersprüchlichkeit von Protest- und Aufstandsbewegungen viel stärker deutlich wird, führt dazu, dass internationale Solidaritätsarbeit heute schwerer geworden ist. Es scheint schwieriger, in den Bewegungen heute Subjekte zu finden, mit deren Positionen man sympathisieren oder sich solidarisieren kann.5
Dennoch erscheint eines solche Solidarität, die nationale und regionale Grenzen überschreitet und eine Zusammenarbeit über sie hinweg möglich macht, bitter nötig. Darauf verweist etwa auch das Erstarken der rechtspopulistischen Kräfte bei der letzten Europawahl: Wo die Menschen zur aktuellen EU-Politik der Zuspitzung sozialer Verhältnisse und der Abwälzung der Krisenfolgen auf die Schwächsten in der Gesellschaft, keine wirkliche Alternative sehen, da haben es zunehmend diejenigen einfach, die den Existenzängsten der Menschen damit begegnen, dass sie den Hass und die Verachtung gegen Arme und gesellschaftlich Schwache schüren, seien es Arbeitslose, Wohnungslose oder Migrant_innen. Dies führt dazu, dass menschenfeindliche Aussagen zunehmend nicht mehr als Skandal aufgenommen werden, sondern als überfälliger Tabubruch, frei nach dem Motto: „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“.
Nicht nur in der Innen-, sondern auch in der Außenpolitik verschiebt sich der Diskurs zunehmend. Dass die deutsche Sicherheitspolitik auch ökonomische Ressourcen und Handelswege sichern helfen soll, wird immer unumwundener ausgesprochen. Die neuen afrikapolitischen Richtlinien der Bundersregierung machen dies ebenso deutlich wie die Aussagen vieler SPD und CDU-Politiker_innen der letzten Zeit. Zugleich verschleiern sowohl die Bemühungen der Verteidigungsministerin um eine „familienfreundliche Bundeswehr“ wie die Tatsache, dass die BRD sich weniger an Kampfeinsätzen als in der Ausbildung von polizeilichen wie militärischen Kräften oder bei der Bereitstellung der Infrastruktur für kriegerische Interventionen beteiligt nur mühsam, was eigentlich auf der Hand liegt: Dass die BRD, 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieg, militärisch wie zivil weltweit so agiert, dass die eigene ökonomische wie politische Macht gesichert und ausgebaut wird und die Bereicherung auf Kosten der Armen wie ihr Ausschluss von wirklicher Teilhabe weitergehen kann.
Internationale Solidaritätsarbeit ist heute bei allen Schwierigkeiten jedoch nicht unmöglich und es gibt ernstzunehmende Versuche und praktische Ansätze wie sie angesichts der vielen Herausforderungen unter den gegebenen Umständen funktionieren kann. Zwei solcher Versuche möchte ich hier kurz beispielhaft skizzieren: Aus einer Vernetzung von Aktivist_innen, die sich im Bereich Antirassismus und gegen die Unterbringung von Geflüchteten in Lagern engagieren, mit nach Mali abgeschobenen Menschen entstand 2010 das Netzwerk afrique-europe-interact. Hier werden Formen verbindlicher und langfristiger Zusammenarbeit entwickelt, die darauf zielen, in Europa und Afrika gemeinsam Strategien im Einsatz gegen Landraub, militärische Konflikte und Interventionen und die EU-Migrations- und Abschottungspolitik zu entwickeln.
Auch innerhalb Europas gab es in den letzten Jahren im Zuge der Proteste gegen die Krisen- und Austeritätspolitik Versuche transnationaler Vernetzung. So bemüht sich etwas das Blockupy-Bündnis, das wiederholt zu Protesten gegen die Politik der Troika aus EZB, EU-Kommission und Internationalem Währungsfond in Frankfurt am Main aufgerufen hat um eine internationale Vernetzung mit Bewegungen in Südeuropa. Dabei geht es nicht nur um die gegenseitige Teilnahme an Aktionstagen oder Demonstrationen, sondern darüberhinaus darum Orte des Austauschs zu schaffen, Interpretationen der momentanen Situation zu diskutieren und gemeinsame Strategien zu finden, wie eine Alternative dazu zu denken und zu schaffen ist.
„Überall ist Taksim – überall ist Widerstand“?!
Solche Versuche, so weit sie momentan auch davon entfernt sein können internationale Solidarität zu einem Anliegen zu machen, das massenhaft Menschen bewegt, zeigen doch erste Ansätze zu einem internationalistischen Bewusstsein. Auch wenn die Formen der Solidarität (noch) nicht ausgeprägt und nur wenig organisiert sind, wird doch immer wieder deutlich, dass, was etwa in der Türkei oder in Brasilien geschieht, auch hier die Menschen bewegen kann, wenn deutlich wird, es geht dort um mehr als um lokale Anliegen, im Kern geht es um ein Leben in Würde und den Widerstand gegen all das, was dieses Leben zu verunmöglichen droht. Ein solches Bewusstsein sprach etwa aus der Parole: „Überall ist Taksim – überall ist Widerstand“. Was dort in der Türkei geschah, die erbarmungslose Unterdrückung eines Protestes gegen ein Einkaufszentrum, das nicht dem guten Leben Vieler in der Stadt, sondern den Profitinteressen weniger dienen sollte, stand für eine Entwicklung, die wir weltweit erleben: wie die Ökonomisierung und Profitorientierung immer weiterer Lebensbereiche, Leben in vielen Fällen behindert und oft sogar auslöscht. Auf einem solchen Zusammenhang beruhte dann auch die Wahrnehmung des Gemeinsamen, dass dieser Widerstand der Menschen in der Türkei bei aller Spezifik, weit über lokale Anliegen hinausgeht, auf etwas zielt, was auch uns alle angeht und deshalb auch zu unserem Widerstand werden kann.
Zugleich kontrastiert die Behauptung „überall ist Widerstand“ doch oftmals schmerzlich mit unserer (Alltags)erfahrung hier in Deutschland, wo wir viel öfter erleben, dass die, „die um ihre Existenz bangen, eher still halten in der Hoffnung, dass sie verschont bleiben, oder in Resignation verfallen, dass die, denen es (noch) gut geht, kaum Zweifel haben an einem wirtschaftlichen und politischen System, das Kriege, Hunger und Tod produziert“6.
Ob wir wirklich in einem „Zeitalter der Aufstände“7 leben, das können wir heute wohl kaum schon abschließen beurteilen. Aber als Christ_innen, die aufgerufen sind, heute nach den Zeichen der Zeit zu fragen, können wir uns bemühen nach Formen der Solidarität zu suchen und Möglichkeiten zu finden, wie wir selber von unseren unterschiedlichen Orten her gemeinsam aufbrechen können, um mit Anderen zusammen gegen Ungerechtigkeiten zu protestieren und uns für ein Leben in Würde für alle Menschen zu engagieren. Die Beiträge in diesem Werkbuch sollen uns dazu ermutigen zu sehen, wo sich solche Aufbrüche schon hier und heute ereignen und unsere Kreativität anregen, wie wir an diesen teilnehmen oder selber in anderer Form Möglichkeiten des Widerstands im Sinne einer Alternative zum Bestehenden ausprobieren und leben können. Sie sollen uns aber auch anregen, diese kleinen Aufbrüche immer wieder zueinander in Beziehung zu setzen und sie in einen globalen Kontext des Ringens so vieler Menschen um ein Leben in Würde zu stellen. In diesem Sinne können sie vielleicht dazu beitragen unsere Hoffnung groß zu machen – auf eine andere, mögliche Welt!
Zur Autorin:
Dr. Julia Lis ist Mitarbeiterin am Institut für Theologie und Politik. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind: Theologie im Kontext sozialer Bewegungen, Flucht und Migration, Kirche der Armen, Projekt „Konzilserinnerung“, Krisenproteste.
*Veröffentlicht in: Institut für Theologie und Politik (Hg.): „Anders Mensch sein in einer anderen Kirche …“. Dokumentation und Weiterführung der Konziliaren Versammlung Frankfurt 2012. Münster 2014. S. 9 – 13.
1Boer, Dick: „Wir aber hatten gehofft“. Text und Subtext in der politischen Geschichte der Großen Erzählung, in: Boer, Dick / Füssel, Kuno / Ramminger, Michael (Hg.): Was verdrängt, aber nicht ausgelöscht werden kann. Diskussion über das Schicksal der Großen Erzählung, Münster 2014, S. 53.
2Vgl. Badiou, Alain: Das Erwachen der Geschichte, Paris 2011, S. 45 – 54.
3Vgl. Badiou: Erwachen der Geschichte, S. 27 – 37.
4Hardt, Michael: Der universelle Zyklus des Kampfes, in: Guttstadt, Tayfun (Hg.): Çapulcu. Die Gezi-Park-Bewegung und die neuen Proteste in der Türkei, Münster 2014.
5Das soll weder bedeuten, dass Solidaritätsarbeit auf internationaler Ebene heute unmöglich ist, noch frühere Solidaritätsbewegungen als problemlos oder widerspruchsfrei verklären. Eine politische Auffassung, die auf ein Leben in Fülle für alle Menschen abzielt, wird nie umhin kommen, global denken zu wollen und innerhalb der unterscheidlichen Konflikte weltweit um Positionierung zu ringen und nach Verbündeten für ihr Anliegen zu fragen.
6Strobel, Katja: Zwischen Selbstbestimmung und Solidarität. Arbeit und Geschlechterverhältnisse im Neolibaeralismus aus feministisch-befreiungstheologischer Perspektive, Münster 2012, S. 19.
7Badiou: Erwachen der Geschichte, S. 15.