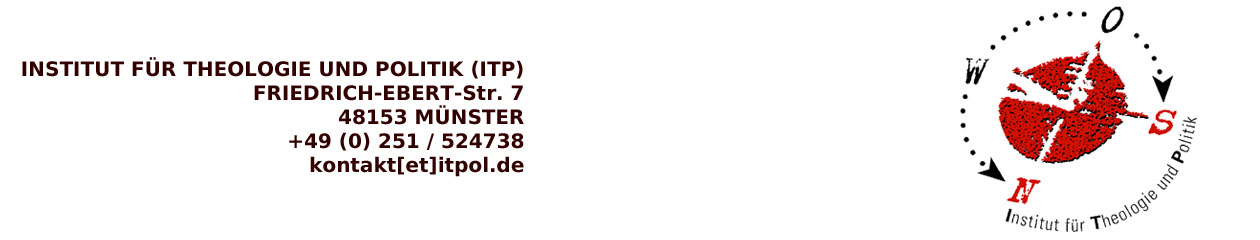Dom Demétrio Valentini
geboren 1940 in São Valentim (Brasilien), ist seit 1982 Bischof und hatte bis vor kurzem das Amt für Sozialpastoral innerhalb der brasilianischen Bischofskonferenz inne. Als Leiter der Sozialpastoral war er zuständig für die Durchführung der Sozialwochen der Kirche Brasiliens. Bei der Generalversammlung in Aparecida gehört er zur brasilianischen Delegation.
Erwartungen an die 5. Generalversammlung
Einleitung: Eine Generalversammlung in Aparecida
Als Papst Johannes Paul II. bei seiner Eröffnungsansprache in Santo Domingo seine Absicht bekannt gab, eine Kontinentalsynode für die gesamte Kirche von Amerika einzuberufen, schien die Geschichte der „Generalversammlungen des Episkopats aus Lateinamerika und der Karibik“ besiegelt. Man hatte den Eindruck, dass es in Zukunft keine „Generalversammlungen“ mehr geben würde, nur noch „Kontinentalsynoden“. Die Kirche Lateinamerikas würde kein eigenes kirchliches Subjekt mehr sein, mit eigenen Initiativen und einer ausgeprägten eigenen Identität. Die Initiativen für ihre „kontinentale Eingliederung“ kämen von Rom und folgten der Strategie, jeweils kontinentbezogen und homogenisierend die Weltkirche zu begleiten.
Diese Sorge bestätigte sich durch die Amerika-Synode im Jahre 1997. Sie war inspiriert vom stets nachdrücklich wiederholten Slogan „Ein einziges Amerika, eine einzige Kirche“.
Tatsächlich schienen nach der Amerika-Synode die Generalversammlungen der Lateinamerikanischen Kirche ihren Sinn verloren zu haben. Dies ging so weit, dass bei der Ankündigung der diesjährigen Generalversammlung manche sogar ihr Befremden bzw. ihren Widerstand zum Ausdruck brachten. In einer der Versammlungen des „postsynodalen Rates“, der aus der Amerika-Synode hervorgegangen war und immer noch existiert, stimmte der kanadische Kardinal Turcotte gegen den Vorschlag, eine Konferenz nur auf lateinamerikanischer Ebene durchzuführen. Eine solche Konferenz scheine dem Anliegen der Amerika-Synode zu widersprechen bzw. es gar zu ignorieren.
Die Gelegenheit, diese quasi fatalistische Haltung hinter sich zu lassen und die Erwartungen umzukehren, ergab sich bei der CELAM-Versammlung 2001 in Caracas, als Kardinal Maradiaga eine neue Konferenz vorschlug mit dem Ziel, ein CELAM-Jubiläum zu begehen. Da fast alle Teilnehmenden zustimmten, wurde der Vorschlag formell angenommen und weiterentwickelt. Man war dazu bereit, ihn zu konkretisieren, und hoffte, es könnte gelingen.
Dass es bis zur Realisierung noch so lange dauerte, weist darauf hin, welch schwierigen Weg der Vorschlag durchlaufen musste. Es war nötig, die Phase des Undenkbaren hinter sich zu lassen, die Phase des Vorstellbaren zu durchlaufen, etwas Realisierbares daraus zu machen und die Zustimmung Johannes Pauls II. zu erlangen, der weiteren lateinamerikanischen „Generalversammlungen“ anscheinend die Befugnis entzogen hatte. Nachdem aber Johannes Paul II. Zustimmung gegeben signalisierte, machte man aus der Absicht, eine neue Generalversammlung einzuberufen, eine Entscheidung.
Dieser entscheidende Schritt ist dem Bemühen des gegenwärtigen CELAM-Präsidenten, Kardinal Errázuriz, zu verdanken. Er hat die Initiative ergriffen, die Kirche Lateinamerikas und der Karibik offiziell zu konsultieren, um deren Meinung einzuholen und diese dem Papst vorzutragen. Von 22 Bischofskonferenzen äußerten sich 20 zugunsten der Durchführung einer „Generalversammlung“. Von 30 lateinamerikanischen Kardinälen waren 18 dafür. Als die Führung des CELAM bei einem Essen dem Papst diese Daten vorlegte, urteilte Johannes Paul II.: „Ich will das, was die Kirche Lateinamerikas will“. Das war das Signal zur Durchführung der Generalversammlung.
Dann überraschte das Hin und Her bei der Auswahl des Ortes, so dass das Ergebnis schließlich einige Fragen offen lässt, die beantwortet werden müssen.
Anfangs kam man überein, die Versammlung in Rom durchzuführen, damit der kranke Papst sie aus der Nähe verfolgen könnte. Doch es war zu spüren, dass diese Übereinkunft nicht zu halten wäre. Man sprach sogar insgeheim nachdrücklich darüber, die Versammlung in Ecuador stattfinden zu lassen, wenn sie in Rom nicht realisierbar wäre. Aber niemand hatte den Mut. öffentlich den Grund zu nennen, der den Ortswechsel hätte möglich machen können.
Nach dem Tod des Papstes, die Begründung für Rom war nun hinfällig geworden, verlor auch Ecuador an Zustimmung, weil zwei andere Orte stärker ins Spiel kamen: Chile, das den CELAM-Präsidenten stellte, und Argentinien, dem der CELAM-Sekretär angehörte. Beide hatten wiederum ihre eigenen Motive, sich in der Lage zu fühlen, die Konferenz bei sich aufzunehmen.
Da geschah das Überraschende: Benedikt XVI. teilte – ebenfalls bei einem Essen mit einigen lateinamerikanischen Kardinälen – seine Entscheidung mit. Es sollte weder Chile noch Argentinien sein. Ich würde sogar behaupten: Auch nicht Brasilien, sondern Aparecida!
Es ist also offensichtlich, dass Aparecida in erster Linie ausgewählt wurde, weil sein Marienheiligtum eine kirchlich symbolische Bedeutung besitzt und weil die Wahl eines Marienheiligtums pastorale Auswirkungen auf die Kirche in Lateinamerika hat.
Der Papst hat für seine Auswahl keine Gründe genannt. Also müssen wir selbst die Gründe herleiten. Der Hauptgrund ist meines Erachtens mit der symbolischen Bedeutung von Aparecida verbunden, mit all den Begleitumständen, die heute das kirchliche Panorama des Heiligtums von Aparecida ausmachen, beginnend bei der „Legende“, die erzählt, dass die Anfänge der Marienverehrung eng mit der Vorstellungswelt, die sich um unsere Liebe Frau von Aparecida gebildet hatte, verbunden ist.
In diesem Sinne ist eine der anstehenden Aufgaben, die symbolische Bedeutung von Aparecida vor allem in den Ländern Lateinamerikas besser zu verbreiten, die Bedeutung dessen, was wir als „Parabel von Aparecida“ bezeichnen könnten. Denn diese ist außerhalb von Brasilien völlig unbekannt.
Aber es ist auch legitim zu fragen, ob Benedikt XVI. nicht auch noch andere Gründe für die Wahl von Aparecida gehabt haben könnte, weil dieser Ort doch in Brasilien liegt.
Ganz falsch kann es nicht sein, sich vorzustellen, dass Benedikt XVI. auch an die Kirche Brasiliens gedacht hat, und an die Bedeutung, die sie im heutigen Kontext von Lateinamerika hat. Ebenso an den Wert ihrer reichen kirchlichen Erfahrung, an ihre Dynamik, die durch das intensive Wirken der Brasilianischen Bischofskonferenz (CNBB), und vor allem von der Basis her durch das „Volk Gottes“ ihren Antrieb erhält. Das Volk hat begeistert und kreativ die pastoralen Orientierungen des II. Vaticanums aufgegriffen und sie in zahllosen „kirchlichen Basisgemeinschaften“ konkretisiert, die gestützt vom Wort Gottes und inspiriert von theologischer Reflexion mit Boden unter den Füßen Standfestigkeit bewiesen.
Die Entscheidung Benedikt XVI. hat deshalb mit der Kirche Brasiliens zu tun, sicher auch, weil der CELAM bei der ersten Generalversammlung 1955 in Brasilien gegründet wurde. Dies ist ja der Hauptgrund für die diesjährige Generalversammlung.
Die Generalversammlung in Aparecida wird auch zu einer Herausforderung für die Kirche Brasiliens. Sie fühlt sich herausgefordert, ihre Vitalität, von der sie in den Zeiten der begeisterten Rezeption des Konzils gekennzeichnet war, zu bezeugen und über ihre heutige Situation Rechenschaft zu geben,
Die Kirche Brasiliens hat bei dieser Versammlung Schulden abzutragen. Und – wer weiß – vielleicht empfand Benedikt XVI. das bei der Wahl von Aparecida ähnlich
oder dachte an andere Schulden, die er selbst gegenüber der brasilianischen Kirche empfindet. Er hat jetzt die große Chance, diese Schulden zu begleichen durch die Reden, die er in Brasilien halten wird, insbesondere durch seine Eröffnungsansprache bei der Generalversammlung in Aparecida. Seine Worte werden mit Sicherheit die Weichen für die Arbeiten der Konferenz stellen. Es wäre aber auch gut, wenn die brasilianischen Bischöfe sich der Aufgabe stellten, bei dieser Konferenz die Charismen wirklich zum Zuge kommen zu lassen, die der Heilige Geist in diesen vergangenen 50 Jahren auf dem Weg mit dem CELAM geweckt hat. Daran will die Konferenz ja feierlich erinnern.
1. Die wichtigsten Erwartungen an Aparecida
Diese Konferenz unterscheidet sich von den vorangegangenen durch die hohen Erwartungen, die an sie gestellt werden. Das ist schon sehr bedeutsam. Denn Erwartungen regen die Mitwirkung an, stärken das Engagement und wecken Bedürfnisse, die beachtet werden müssen, aber auch das Risiko von Enttäuschungen in sich tragen, die möglichst vermieden werden sollten.
Erwartungen sind gut, denn sie wecken Hoffnungen. Aber sie bringen uns auch unter Druck, denn sie präsentieren eine Rechnung, die wir zu zahlen haben. Menschlich betrachtet ist es sehr kühn, eine solche Konferenz durchzuführen und damit so viele Wünsche zu wecken, die verwirklicht werden wollen. Die Hoffnungen, die im Volk Gottes geweckt worden sind, dürfen nicht enttäuscht werden.
Zunächst empfiehlt es sich genau nachzusehen, woher diese Erwartungen stammen. Zuerst resultieren sie vielleicht aus der Überraschung, dass es überhaupt wieder eine Konferenz geben solle. Weil es schien, dass es solche Konferenzen nie mehr geben solle, und dann plötzlich doch diese Konferenz angekündigt wurde, wuchs die Überzeugung, die Chance, die niemand mehr für möglich gehalten hatte, müsse gut genutzt werden.
Ein anderes Motiv resultiert aus der Tatsache, dass die 5. Generalversammlung ein Jubiläum begehen will. Der Gedanke des CELAM-Jubiläums stand ganz am Anfang und wurde – wie bereits erwähnt – bei der Versammlung in Caracas 2001 ins Spiel gebracht.
Wegen des Jubiläumscharakters steht die Konferenz von Aparecida vor der Aufgabe, die anfänglichen Ziele wieder aufzugreifen, den Weg wieder frei zu machen, eingegangene Verpflichtungen wieder zu übernehmen, verlorengegangene Werte zurückzugewinnen und die eigene Identität wiederzufinden.
Andere Erwartungen an Aparecida resultieren aus der Wahrnehmung, dass für die Kirche in Lateinamerika und in der Karibik die Stunde gekommen ist, sich mit der neuen Realität auseinander zu setzen, die sich aus den tiefgreifenden Umwälzungen der letzten Jahrzehnte ergeben hat. Die Umwälzungen hatten massive Auswirkungen insbesondere auf die Kirche. So wird die Konferenz von Aparecida zu einer Chance für die Kirche, sich angesichts der neuen Realität eines sich in tiefer Umwälzung befindlichen Kontinents neu zu positionieren. Seine Identität wird sich sehr schnell aus der engen Verbindung mit der katholischen Kirche lösen, so dass diese sich einerseits in Frage gestellt sieht und sich andererseits fragen wird, was sie tun muss, um auch in der zukünftigen Geschichte für ein Volk von Bedeutung zu sein, das sich nicht mehr verpflichtet fühlt, sich mit ihr zu identifizieren.
So wird Aparecida zu einem privilegierten Moment, einer Gnadenstunde, zu einer Chance, die man sich nicht entgehen lassen sollte, zu einem kairos für die Kirche, den Anruf zu hören, den der Heilige Geist durch die Realität an sie richtet; denn diese fordert eine neue, fruchtbringende Begegnung mit dem Evangelium Christi und neue Ausdrucksformen für die Kirche.
Wird Aparecida so viele Erwartungen berücksichtigen können? Sicherlich sind die Tage der Konferenz selbst zu kurz für alle diese Erwartungen, und das erhoffte Dokument wird nicht in der Lage sein, alle Wünsche zu erfüllen. Umso wichtiger ist es, Aparecida nicht als isoliertes Ereignis zu verstehen, sondern als einen Prozess, der bereits begonnen hat und den das Schlussdokument daher auch offen lassen muss, damit er weiter geht und sich noch vertieft.
Man fühlt sich bereits erleichtert, wenn man sich klar macht, dass das Ganze nicht in einem Dokument einzufangen ist, das von einer Bischofsversammlung verfasst wird. Das Dokument wird also nicht das einzige Mittel sein, auf das sich die Hoffnungen von Aparecida konzentrieren sollten. Auch wir selbst müssen sie weitertragen!
Daher ist der Prozess innerhalb der Kirche so wichtig, der vor der Generalversammlung des Episkopats in unserem Kontinent in Gang gekommen ist. Die Versammlung findet auf der Ebene der Bischöfe statt, aber ihre Dimension erfasst die gesamte Kirche. Weil das so ist, sind wir alle aufgefordert, uns aktiv zu beteiligen.
Aus diesem Grunde begrüße ich Initiativen wie die, die uns hier zusammengeführt hat. Es ist wichtig, einander darin zu bestärken, sich gemeinsam mit all den Problemen zu beschäftigen, die uns als Christen herausfordern.
Damit ist der wichtigste Grund gegeben, uns für dieses „kirchliche“ Ereignis zu interessieren; es verweist uns auf das wichtigste Anliegen, nämlich auf das Evangelium. Wenn das Evangelium im Spiel ist, sind wir alle gefragt.
Und dies wiederum verweist auf die eigentliche Dimension dieses Ereignisses, auf seinen Charakter, der dem Evangelium entspricht. Das Thema der Konferenz stellt Jesus Christus in die Mitte: „Jünger und Missionare Jesu Christi!“
Die Kirche kann sich in einer Krise befinden, aber das Evangelium Jesu behält unverändert seine Gültigkeit. Viele fürchten, dass das „Christentum“ in seiner historischen Gestalt, die als westliche Kultur in Erscheinung trat, verschwinden könnte. Es mag sogar verschwinden oder sich tiefgreifend verändern. Aber die Sache des Evangeliums geht weiter.
In diesem Sinne finden die Erwartungen für Aparecida ihren angemessensten Horizont in der Kraft des Evangeliums, das – wie Paulus sagt – „niemals gefangen genommen werden kann“.
2. Vom Optimismus zur Krise – Verlauf der letzten 50 Jahre
Ohne die Geschichte können wir die Ereignisse nicht angemessen verstehen. Die vergangenen 50 Jahre, an die wegen des Jubiläumscharakters der Konferenz von Aparecida erinnert werden soll, waren von tiefgreifenden Veränderungen gezeichnet. Es ist interessant, die Abfolge der Ereignisse in den einzelnen Jahrzehnten zu verfolgen.
Ein Ereignis drängt sich sofort auf und hilft uns zu verstehen, warum sich die Kirche heute in Schwierigkeiten befindet. Es ist schwer, die großen Hoffnungen des Konzils in die Praxis umzusetzen. Die Umsetzung des Konzils befindet sich in einer Krise. Und warum? Weil das Konzil selbst in einer Zeit von großem Optimismus stattfand, aber seine Umsetzung in eine Zeit fiel, die von aufeinanderfolgenden Krisen gekennzeichnet war.
Der große Impuls zur kirchlichen Erneuerung in unserer Zeit entstand in der Epoche eines umfassenden Optimismus, vieler Utopien, in einem Klima der Euphorie vor allem in Europa, das sich nach dem zweiten Weltkrieg wieder neu belebte. Die 50er und 60er Jahre, in denen der CELAM gegründet wurde und das II. Vaticanum stattfand, waren die optimistischsten Dekaden der letzten Jahrhunderte.
Die Konferenz von Aparecida ist aufgerufen, die Hoffnungen des Konzils wieder aufzugreifen, aber mit mehr Realismus und klarerem Bewusstsein für die Schwierigkeiten, denen man entschlossen begegnen muss.
Die 50er Jahre waren voller Initiativen, die Hoffnungen säten. 1952 wurde die Brasilianische Bischofskonferenz (CNBB) gegründet. 1955 wurde die Lateinamerikanische Bischofskonferenz (CELAM) gegründet, als Ergebnis der ersten Generalversammlung von Rio de Janeiro. 1956 wurde Caritas Brasilien gegründet. Und im Januar 1959 kündigte Johannes XXIII. das Konzil an, dessen Idee später von allen enthusiastisch aufgegriffen wurde. Von da an konzentrierten sich der Optimismus und die Hoffnungen ganz auf das Ereignis des II. Vatikanischen Konzils, das Mitte der 60er Jahre stattfand.
Aber kaum war die Dekade des Optimismus zu Ende, als sich die ersten Anzeichen für eine Reihe von Krisen zeigten, die vor allem Europa ängstigten und die Anwendung des Konzils in Mitleidenschaft zogen.
Das erste Anzeichen war die „Studentenrevolte“ 1968. Dieses Ereignis offenbarte die Krise der Moderne mit aller Deutlichkeit. Es machte viele Theologen ganz perplex, insbesondere einen, der später in der Kirche großen Erfolg hatte …(Anm. des Übersetzers: Valentini spielt hier auf Ratzinger an!)
Bemerkenswert ist vor allem die folgende Koinzidenz:
In dem Jahr, in dem sich die Kirche Lateinamerikas in Medellin versammelte, um das Konzil in aller Offenheit aufzunehmen, erschrak Europa über die Krise der Moderne und begann, durch die Rückkehr zu institutionellen Zufluchtsorten Sicherheit zu suchen, in einer Gegen-Bewegung zum Konzil, das vorgeschlagen hatte, die Kirche mit der „modernen Welt“ zu versöhnen.
Sich diese Zusammenhänge zu vergegenwärtigen, ist wichtig, um die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Konzils und auch das Auseinanderdriften des Weges der lateinamerikanischen Kirche und der Sorgen Roms, das die Spannung der kulturellen Krise in Europa aus der Nähe erlebte, zu begreifen.
Ein schneller Durchgang durch die folgenden Jahrzehnte zeigt uns eine Reihe von Krisen, die einen weitreichenden Einfluss auf unsere heutige Realität haben sollten.
Die 70er Jahre waren gekennzeichnet durch die „Ölkrise“ mit Preisexplosionen und dem Aufkommen der sogenannten „Petro-Dollars“. Die westlichen Banken horteten diese bei sich und verwandelten sie in eine Quelle leicht zugänglicher, umfangreicher Kredite für Entwicklungsländer.
Daraus resultierte in den 80er Jahren die „Schuldenkrise“, die unsere Länder zutiefst charakterisierte und die bis heute andauert. Die Schuldenkrise erklärt zugleich den Übergang vom „produktiven Kapitalismus“ zum spekulativen „Finanzkapitalismus“.
Das Ende der 80er Jahre war gekennzeichnet durch die Krise des Sozialismus mit dem Fall der Berliner Mauer 1989, dem Symbol für die tiefgreifenden Veränderungen in Osteuropa, die 1991 zum Zusammenbruch der Sowjetunion führten.
In den 90er Jahren entwickelte sich die Globalisierung unter dem Kommando des Neoliberalismus. Das bedeutete Förderung von Privatisierungen, Abbau des „Sozialstaats“, Abschied von kollektiven Utopien, Deregulierung des Staates, Übertreibung des individuellen Erfolgsstrebens und der Finanzmacht, unterschiedslose Öffnung aller Märkte. Die Globalisierung trat mit dem Anspruch auf, definitiv die Probleme der Entwicklung zu lösen, und die „einzige Wahrheit“ zu sein, die die Geschichte ohne Widersprüche voranbringen könnte.
3. Überwindung der Sackgassen – dringende Aufgabe von heute
Die Sackgassen, in die eine von Ausschluss und Machtkonzentration bestimmte Globalisierung führte, zeigten sich sehr bald:
- Krise der ökologischen Nachhaltigkeit
- Ausbreitung von Ausschluss und Gewalt
- Krise der ethischen Werte
- Verlust von subjektiver und kultureller Identität
- Krise der Solidarität
Gegen den Anschein, das neue Jahrtausend könnte die Utopien bald in Realität überführen, begann es mit einer tiefen Zivilisationskrise, die alle Institutionen erfasste, auch die Kirche.
In diesem weiten historischen Kontext wird die 5. Generalversammlung von Aparecida stattfinden. Die Probleme, denen sie sich gegenübersieht, sind nicht einfach.
Dennoch, je umfassender die Krise, umso größer die Chance für das Evangelium das als fruchtbarer, unerschöpflicher Entwurf für die Einbeziehung der Ausgeschlossenen, für Geschwisterlichkeit und auch für die Versöhnung mit der Natur gültig bleibt. Je deutlicher der Kollaps menschlicher Entwürfe wird, umso mehr öffnet sich der Weg für das Handeln Gottes. Wie zu den Zeiten Jesu können auch wir heute ahnen: „Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium!“
Deswegen ist die wichtigste Aufgabe der 5. Generalversammlung, die Bedeutung des Evangeliums Jesu und die Wege, die uns zu ihm führen, zu entdecken.
Ein Ausweg aus der Sackgasse, die durch die heutige Zivilisationskrise entstanden ist, wird durch strukturelle Veränderungen der Kirche nicht möglich sein; es bedarf dagegen einer vertieften Rückbesinnung auf das Evangelium. Die Erfahrung eines für alle offenen Evangeliums wird die Kraft für notwendige Veränderungen im Leben der Kirche wecken.
4. Die bedeutsamen Einsichten des Konzils wieder aufgreifen
Johannes XXIII. fasste die Einsichten des Konzils in zwei sehr dynamischen Ideen zusammen:
- Rückkehr zu den Quellen
- Heutigwerden der Kirche – „aggiornamento“
Comblin schlägt vor, einige Einsichten Johannes’ XXIII, die Ausdruck dieser beiden Grundideen sind, wieder ins Bewusstsein zu bringen.
In erster Linie wären die Verurteilungen zu beenden und durch einen Dialog zu ersetzen, der die miteinander konfrontierten Positionen gegenseitig voranbringt. Comblin hat voller Sorge beobachtet, dass im Gegensatz dazu in den letzten Jahrzehnten 100 katholische Theologen verurteilt wurden; diese Situation hat schließlich jegliches Theologietreiben selbst unterbunden.
Dann merkt er an, dass Johannes XXIII. ein „Pastoral“-Konzil wollte. Dieses Attribut hat nichts Geringschätziges an sich, im Gegenteil, es gibt den „Hirten“ die Kompetenz zu entscheiden, was für die Kirche gut ist, und lässt den „Pastoraltheologen“ die Aufgabe, die entsprechenden Reflexionen anzustellen.
Comblin sagt weiter, dass es die Absicht des Konzils war, dass sich die Katholische Kirche der ökumenischen Bewegung öffne. Aber dieser Ökumenismus dürfe sich nicht auf die kleinen Gruppen des historischen Protestantismus beschränken, sondern müsse sich für das weit verbreitete Phänomen der Pfingstbewegung öffnen. Das II. Vaticanum hat eine Besonderheit, durch die es sich von allen anderen Konzilien unterscheidet: Es wurde nicht einberufen, um ein bestimmtes Problem zu lösen, wie das bei anderen Konzilien der Fall war; sondern vielmehr kam es zustande durch die prophetische Initiative eines Papstes in einem Moment, in dem die Kirche als Institution in Ruhe und Sicherheit existierte. Nötig war das Konzil eigentlich nicht, vielleicht war es auch gar nicht angebracht. Zumindest dachten diejenigen so, die alles so lassen wollten, wie es war.
Die Probleme begannen erst nach dem Konzil und brachten seine Umsetzung in Gefahr. Das Konzil, das nach den eindrucksvollen Worten von Kardinal Lercaro, „die Türen weit geöffnet lassen sollte“, um weiter voran zu kommen, erlebte dann das Gegenteil: die Türen für weitere tiefgreifende Änderungen in der Kirche wurden wieder geschlossen, die konservative Strömung mit dem Blick zurück wurde gestärkt durch eine stärkere Kontrolle seitens des Zentrums, das durchgreifende Veränderungen fürchtete.
Heute laufen die gehaltvollen Einsichten des 2. Vaticanums Gefahr, unwirksam zu werden. Deshalb ist es die Aufgabe der 5. Generalversammlung, die großen Einsichten des Konzils wieder aufzugreifen und darin die Motivationskraft zu finden, die kirchliche Erneuerung in Lateinamerika fortzusetzen in dem Bemühen, die historischen Realitäten des Kontinents wieder stärker in den Blick zu nehmen.
Einige dieser Einsichten sollen kurz erwähnt werden:
- Die Ekklesiologie des II. Vaticanum, die auf dem Verständnis der Kirche als Volk Gottes gegründet ist, wieder beachten. Diese Ekklesiologie impliziert eine Wertschätzung der Laien und stellt vehement das Amtsverständnis in der Kirche auf den Prüfstand, beginnend beim „petrinischen Dienstamt“ über die ordinierten Ämter bis zu den Ämtern, die in den Gemeinden benötigt werden.
- Die „bischöfliche Kollegialität“ als Garantie für die Einheit in Verschiedenheit und als Grundlage für die Konkretisierung der Kirche in „Lokalkirchen“ wieder aufnehmen.
- Die Bischofskonferenzen, die angeregt werden sollen, ihre eigenen Verantwortlichkeiten wahrzunehmen, stärker beachten.
- Die „kirchlichen Basisgemeinschaften“ als Inkarnation der Kirche in den Realitäten des Volkes und als praktische Erfahrung von Kirche ansehen.
So wichtig auch das II. Vaticanum gewesen ist, heutzutage erleben wir so tiefgreifende Veränderungen, dass es nicht ausreicht, sich von den Kriterien und Orientierungen des Konzils leiten zu lassen.
Wir müssen noch weiter zurückgreifen auf die Inspirationen der Urkirche und auf die Quellen des Evangeliums, wie Jesus es historisch gelebt, praktiziert und verkündet hat. Grundlegende Bezugspunkte sind also die Urkirche und das in seiner historischen Dimension verstandene Evangelium Jesu.
5. Die Praxis der Urkirche wiederbeleben
Wenn wir uns auf die Urkirche beziehen, ist es aus verschiedenen Gründen wichtig, die Apostelgeschichte heranzuziehen.
Zunächst um erneut den Weg nachzuzeichnen, den Lukas für die Kirche in den Worten beschreibt, die er Jesus in den Mund legt: „Ihr seid meine Zeugen in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Grenzen der Erde“ (Ap 1,8). Mit diesen Worten Jesu beschreibt Lukas den Leitfaden seines Werkes. Die Apostelgeschichte zeichnet das Entstehen der Kirche in Jerusalem nach, ihre weitere Ausdehnung über Judäa sowie Samaria und endet schließlich damit, dass Paulus sich in Rom, der Hauptstadt des Kaiserreiches, aufhält. Es scheint so, als sei die Apostelgeschichte unvollständig geblieben. Aber nein! Rom bedeutet für Lukas die „Grenzen der Erde“. Mit dem Ende in Rom macht Lukas die Darstellung komplett, die er sich vorgenommen hatte.
Die okzidentale Kirche hat diese Darstellung auf reduzierte Weise gedeutet, als ob die Apostelgeschichte Rom – als lokale und statische Größe – zum Zielpunkt des Evangeliums gemacht habe. Im Gegenteil, Rom war die Hauptstadt der Welt, die Paulus zu evangelisieren sich mühte. Rom stand als Symbol dafür, dass die Apostel das Banner des Evangeliums „im Herzen der Welt“ errichtet hatten.
In diesem Sinne ist das Rom der Apostelgeschichte ein dynamischer Bezugspunkt, eine ständige Aufforderung, Grenzen zu überschreiten. Nicht Mauern zu errichten, sondern das Banner des Evangeliums immer wieder unter den Umständen jeder Epoche in das Herz der Welt einzupflanzen
Die Apostelgeschichte enthält zwei weitere wichtige und hilfreiche Dimensionen, die heute von der Kirche dringend aufgegriffen werden müssten:
- Die Inkulturation des Glaubens
- Die Wertschätzung des Konzils auf der Grundlage der Erfahrung des „Konzils von Jerusalem“.
Die Kirche verfügt bis heute nur über eine einzige tiefreichend gelungene Inkulturationserfahrung des Evangeliums, nämlich die Art und Weise, wie sie sich auf die griechisch-römische Kultur einließ. Daraus ist eine Kirchengestalt hervorgegangen, die bis heute andauert.
(Es gab natürlich auch noch andere Inkulturationserfahrungen, die heute mehr beachtet und als mögliche Bezugspunkte für Inkulturation in der Welt von heute aufgegriffen werden sollten, wie zum Beispiel die frühen Ostkirchen und die afrikanischen Kirchen.)
Was die Urkirche im Kontext des römischen Imperiums leistete, müsste die Kirche heute fortsetzen: Wieder mit der Kraft des Heiligen Geistes, in Treue zum Evangelium, aber auch in der Freiheit, Elemente der Kultur und Religiosität des einfachen Volkes akzeptierend aufgreifen, so dass Kirchen entstehen, die menschlich von den soziokulturellen Realitäten der Völker und Kontinente geprägt sind, in denen sie leben.
Dass dieser umfassende Inkulturationsprozess nicht stattgefunden hat, mag in gewisser Weise erklären, warum die Kirche Schwierigkeiten hat, in alten Kulturen zu leben, wie in Indien, China, Japan und anderen Ländern. Aber das erklärt auch, warum die Kirche heute größere Freiheit lassen müsste, um sich in der Moderne und Postmoderne auch hier in Lateinamerika inkulturieren zu können.
Deshalb wird in Aparecida eine der Hauptsorgen sein, wie sich das Evangelium neu inkulturieren kann, auch mit den entsprechenden Konsequenzen, die das für die Kirche bedeutet.
Aber die Apostelgeschichte präsentiert uns noch ein anderes, selten wahrgenommenes wichtiges Zeugnis. Sie zeigt nämlich, wie wichtig das „Konzil von Jerusalem“ war, das durch die Flexibilisierung des Beschneidungsgebotes den christlichen Glauben in heidnischer Umgebung akzeptabel machte. Aber die Apostelgeschichte zeigt auch, dass die Entscheidungen des Konzils bedingungslos von allen ideologischen Strömungen der Kirche akzeptiert und daher zum verpflichtenden Bestandteil kirchlichen Handelns wurden.
Sowohl die „konservative Rechte“, vertreten durch die Kirche von Jerusalem, als auch die „progressive Linke“, vertreten durch Paulus und Barnabas, akzeptierten die Entscheidungen des Konzils und ließen sich von ihnen leiten. Das lässt sich im Laufe der Apostelgeschichte gut verfolgen. Zwei Zitate genügen:
Apg 16,4-5: „Als sie (Paulus und Timotheus) nun durch die Städte zogen, überbrachten sie ihnen die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse und trugen ihnen auf, sich daran zu halten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und wuchsen von Tag zu Tag.“
Als Paulus vor seiner Romreise zuerst nach Jerusalem reiste, sagten die Mitglieder der Kirche von Jerusalem zu ihm (in Apg 21,25): „Über die gläubig gewordenen Heiden aber haben wir ja einen Beschluss gefasst und ihnen geschrieben, sie sollten sich vor Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktem und Unzucht hüten.“ Damit zitieren sie wörtlich den Konzilsbeschluss (vgl. Apg 15,29).
Genau dies hat dem II. Vaticanum gefehlt. Schon bevor es beendet war, stellte die „konservative Rechte“ das Konzil in Frage und begann systematisch daran zu arbeiten, dessen Umsetzung zu untergraben, und zwar in eben den Bereichen, die heute eine „Neuinkulturation des Evangeliums“ begünstigen bzw. neue, autonomere und besser inkarnierte Artikulationsformen der Kirche entstehen lassen könnten: die praktischen Konsequenzen „bischöflicher Kollegialität“, das Verständnis der Kirche als „Volk Gottes“, die Wertschätzung der Laien, die ökumenische Bewegung, der interreligiöse Dialog (der anerkennt, dass der Heilige Geist auch in anderen Realitäten außerhalb der katholischen Kirche wirkt), die Bedeutung der irdischen Wirklichkeiten und der Respekt vor ihrer Autonomie.
6. Originalität und Kraft des Evangeliums Jesu zurückgewinnen
Die heutige Situation der Kirche – nicht nur in Lateinamerika, sondern in aller Welt – verlangt eine bewusste und ausdauernde Anstrengung, um das Evangelium Jesu in seiner Ganzheit, mit seinen großen Inspirationen und seinen äußerst radikalen Konsequenzen, zurückzugewinnen.
Nur eine neue, vertiefte Identifikation der Kirche mit dem Evangelium wird ihr Glaubwürdigkeit und Hoffnung geben. Wie Franz von Assisi, der das Evangelium zur praktischen Regel seiner Gemeinschaft machte, muss die Kirche heute den Mut haben, genau zu verstehen, was Jesus tat, damit sie es ebenfalls tun kann, ohne sich zu fragen, ob das Empörung hervorrufen, Gefühle verletzen und vor allem, ob es sich gegen etablierte Privilegien oder Macht- und Herrschaftsinteressen richten könnte. Einige zentrale Dimensionen von Jesu Evangelium will ich hier nennen:
6.1. Die Dynamik der Inkarnation
Das Evangelium ist grundsätzlich mehr von Fakten als von Worten bestimmt. Das erste Faktum ist die Inkarnation des Wortes in Jesus von Nazareth. Der Inkarnationsprozess findet seine Fortsetzung im Entstehen der Kirche Christi. Der Heilige Geist führt sie, damit sie die Realitäten ihrer jeweiligen Epoche aufgreift und sie zum Sakrament der Gegenwart Gottes sowie zur Offenbarung seiner Gnade macht. So sollte die Kirche handeln.
Die Inkarnation ist der wegweisende Grund, von dem jeder Inkulturationsprozess ausgeht und bestimmt wird. Der Inkulturationsprozess bringt die Kraft des Heiligen Geistes zum Ausdruck, der immer noch die Geschichte dadurch belebt, dass er Gottes Heilshandeln offenbart und wirksam macht.
6.2. Der Historische Kontext des Evangeliums
Das Evangelium erzählt weniger von Fakten, als davon, wie Jesus auf bestimmte Fakten reagiert, die sein Leben und seine zwischenmenschlichen Beziehungen prägen. Es ist also wichtig, sich auf das zu besinnen, was diese Fakten wirklich ausmacht, um besser zu verstehen, wie Jesus handelte.
Deshalb sagt man, es sei heute für die Kirche unverzichtbar, sich auf den „historischen Jesus“ zu beziehen, wenn man den Kern des Evangeliums wiederfinden möchte. Es geht nicht darum, durch eine Art archäologischer Arbeit antike Lebensumstände wiederherzustellen, um sie heute künstlich zu imitieren. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns auf den historischen Jesus beziehen, werden wir die Lebensumstände relativieren können, um das Handeln Christi besser einzuschätzen, das die Wahrheit seines Evangeliums ausmacht.
Daher ist es wichtig, die großen Optionen Jesu, seine Verhaltensweisen genau zu bestimmen, die am besten sein Mysterium offenbaren, die am besten seine Absichten zu erkennen geben und die am deutlichsten zur echten Praxis seines Evangeliums führen. Welche sind das?
6.2.1 Seine Mystik
In erster Linie war Jesus erfüllt vom Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist versteht man Jesus nicht. Durch seine Mystik
- lebte Jesus in ständiger Kommunikation mit seinem Vater
- ließ er sich ganz vom Heiligen Geist leiten, völlig frei und jederzeit bereit, in der Kraft zu handeln, die der Geist ihm eingab
- und war ständig erfüllt von der Utopie des Reiches Gottes, die all sein Sehnen und sein Sorgen bestimmte.
6.2.2 Seine eindeutige Option für die Schwächsten, die Ausgeschlossenen, die Kleinen, die Einfachen, die Sünder und die Armen
Es ist sehr wichtig, die Tragweite dieser Option Jesu neu aufzugreifen. Er hätte sehr wohl nach den Mächtigen, den Prominenten oder nach den religiös und gesellschaftlich Einflussreichen suchen können. Er hatte alle Voraussetzungen dazu, schon mit zwölf Jahren. Doch er bevorzugte eindeutig die „Einfachen und Gedemütigten“ und rechtfertigte seine Option, weil er sich durch seinen Vater gestützt fühlte. Deshalb suchte er nach der tiefsten und radikalsten Rechtfertigung seiner entschieden und bewusst getroffenen „Option“: „Ja, Vater, so hat es dir gefallen“ (Mt 11,26), rief er aus, als er sich darüber freute, dass die Armen die Botschaft annahmen, „weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast.“ (Mt 11,25)
Die Option Jesu für die Armen war also nicht strategisch und nicht von den Umständen bestimmt. Sie stammte aus den Tiefenschichten seiner Identifikation mit dem Mysterium des Vaters. Sie ist untrennbar mit seinem Evangelium verbunden. Die von Gott ausgewählte Eingangstür zum Mysterium der Erlösung sind die Armen. Durch sie finden wir zum Reich Gottes.
6.2.3. Die Wertschätzung des/der „Anderen“, des/der Verschiedenen, des/der Fremden
Beeindruckend ist es zu sehen, welche Leidenschaft Jesus für den/die „Anderen“ hatte. Viele Male stand er am Ufer des Sees und drängte darauf, „ans andere Ufer“ zu fahren. Was sollte diese Obsession? Reichte die hiesige Seite nicht aus zum Fischen?
Dieses Handeln Jesu offenbart zutiefst das Geheimnis der Dreifaltigkeit und weist darauf hin, wie dringend und notwendig es ist, sich dem/der Anderen, dem/der Andersartigen, zu öffnen und in ihm/ihr auf noch tiefere Weise unsere eigene Identität zu finden.
Das Gleiche müssen wir von der Wertschätzung sagen, die Jesus für die Fremden empfand. Er half dem fremden Hauptmann sofort und lobte seinen Glauben. Er war sich der territorialen Begrenzung seines Handelns bewusst, aber achtete mit Sorgfalt darauf, alle Grenzen zu überschreiten, die sein Land umgaben: In den Süden nach Ägypten floh er als Kind, im Norden ging er nach Tyrus und Sidon, im Nordosten nach Cäsarea Filippi, weiter unten ins „Gebiet von Gerasa“, und im Osten ging er „jenseits des Jordan“.
Jesus lehrt uns alle Grenzen zu überschreiten und uns zu öffnen für größere Horizonte.
6.2.4. Die Änderung der Mentalität
Jesus bemühte sich ständig darum, die Mentalität seiner Jünger und auch des Volkes selbst zu ändern. Er tat alles, um das Denken und die Herzen zu erweitern, damit sie zur Übereinstimmung mit dem großherzigen Willen der Barmherzigkeit des Vaters gelangten, der alle in seine Liebe einbeziehen will.
Das bemerkenswerteste Beispiel dafür ist die Veränderung, die Jesus im Verhältnis zu den „Samaritern“ erreichte. Sie waren eine Art „Protestanten“ im Alten Testament, halbe Häretiker und Getrennte. Für die Juden gab es nur „schlechte Samariter“. Da Jesus den Samaritern in aller Offenheit begegnete, gelang es ihm, die Vorstellung vom „guten Samariter“ im Denken einzupflanzen. Diese Verwandlung wirkte viel tiefer als die Verwandlung von Wasser in Wein.
Um die Beziehung zu den Samaritern zu verändern, hatte er ein umfassendes Programm in Gang gesetzt. Er machte Samaria zu einem verpflichtenden Ort für sein Wanderungen („musste durch Samaria gehen“), sprach bereitwillig mit der samaritischen Frau, ließ sich von den Samaritern aufnehmen, tadelte die Jünger, die heftig auf die Zurückweisung durch die Samariter reagieren wollten. In der Geschichte von den zehn Aussätzigen erweist sich nur der Samariter als dankbar. Und schließlich hat die wunderbare Parabel von dem Menschen, der am Wegrand liegengeblieben war, auf immer das Bild des „barmherzigen Samariters“ geprägt. Heute müsste die Kirche „samaritisch“ sein.
Diese Haltung Jesu gegenüber den Samaritern erklärt, warum die Urkirche eine so großzügige Aufnahme in Samaria fand. Ganz sicher erinnerten sich die Samariter genau, wie sehr Jesus sie schätzte.
Wie sollen wir diese Haltung Jesu gegenüber den „Samaritern“ von heute verstehen? Sind wir fähig, sie und uns in „barmherzige Samariter“ zu verwandeln“?
6.2.5. Die harte Konfrontation mit den Gegnern des Reiches Gottes
Auch dieser Teil gehört zum Evangelium, das Jesus gelebt hat. Er widersprach allen, die die Kleinen ausbeuteten und sie in Vorurteilen gefangen hielten, die sie daran hinderten, die Werte des Reiches Gottes zu leben. Er hing nicht einer bestimmten Ideologie an oder stritt um Ideen. Er ergriff Partei für die Armen und stellte sich in den Dienst des Lebens. Er hatte keinerlei Vorurteile. Er war gerne zu Gast im Hause des Zachäus und des Simon; er konnte den Pharisäer ehren, der „nicht fern vom Reiche Gottes“ war. Aber er blieb unbeugsam, wenn die Pharisäer oder die eigenen Jünger den Werten des Reiches Gottes widersprachen. Er lebte in jeder Hinsicht stimmig.
Diese kurzen Hinweise mögen genügen, um zu zeigen, wie sehr das Evangelium Jesu immer noch gilt und herausfordert, und wie es immer noch eine Antwort sein kann für alle, die „nach Gerechtigkeit hungern und dürsten“.
7. Aufgaben der 5. Generalversammlung
Was können wir von der 5. Generalversammlung im Hinblick auf diese bedeutsamen Bezugsgrößen – II. Vaticanum, Urkirche, Evangelium des historischen Jesus – erwarten?
Zunächst dürfen wir nicht zu viel erwarten! Wir dürfen nicht zu viel verlangen! Aber mindestens sollte die Konferenz dazu anregen, die Werte des bisherigen kirchlichen Weges auf unserem Kontinent wieder aufzugreifen und die Türen für zukünftige Fortschritte offen zu lassen.
Man erwartet von dieser Konferenz kein langes theoretisches Dokument, das voller Lehren ist. Solche Dokumente hat die Kirche in den letzten Jahrzehnten reichlich veröffentlicht.
Deshalb sagen wir, dass es die Aufgabe dieser Konferenz ist, große strategische, dem Evangelium entsprechende Optionen zu treffen, die den Weg für weitere Entwicklungen öffnen.
Zusammengefasst: Aparecida ist dazu aufgerufen, wieder aufzugreifen, neu zu bestätigen und Fortschritte zu machen.
7.1. Wieder aufgegriffen werden sollte
die für die Kirche Lateinamerikas charakteristische Methode, die bei der Generalversammlung in Santo Domingo aufgegeben wurde: Ausgehen von der Realität in der bekannten Dynamik von SEHEN, URTEILEN und HANDELN. In Wahrheit steht hier die Praxis Jesu auf dem Spiel, der von der Realität ausging, um in ihr – inspiriert vom Heiligen Geist – handeln zu können. Es geht also nicht um irgendeine äußerliche Form bzw. Folgerung aus einem Dokument der Konferenz, sondern um ihre Optionen, die sich aus der Nachfolge der Praxis Jesu ergeben. Dazu gehören:
- Die Inkulturation des Evangeliums, die eine bloß oberflächliche Interkulturalität hinter sich lassen muss. Eine wahrhaftige und seriös praktizierte Inkulturation zieht umfassende Konsequenzen auch für das kirchliche Leben nach sich. Diese sind vom Evangelium selbst legitimiert, und nicht durch juristische Vollmachten oder durch wohlwollende Konzessionen; als solche müssen sie aufgenommen und verwirklicht werden.
- Die Ekklesiologie der Lokalkirche
- Die zentrale Rolle der „bischöflichen Kollegialität“ für die Kirche
- Die Bedeutung der Bischofskonferenzen
- Das historische Gedächtnis des bisherigen Weges der Kirche in Lateinamerika und der Karibik:
- In Kirche und Gesellschaft sind die Armen Subjekte, die sich zu Wort melden
- Die Option der Kirche für die Armen
- Die Offenlegung ungerechter Strukturen
- Die Befreiungstheologie
- Die kirchlichen Basisgemeinschaften
- Die Nähe der Hirten zum einfachen Volk
- Die in den Basisgemeinden integrierten Orden
- Die von Laien wahrgenommenen Ämter
- Das erwachende Selbstbewusstsein der Marginalisierten, der Indígenas, der AfroamerikanerInnen, der Frauen, der Jugendlichen.
7.2. Neu bestätigt werden sollte:
- Der Primat des Wortes Gottes für das Leben der Kirche. Die Bibel in die Mitte des Volkes stellen, um die Realitäten von heute zu beleuchten und wiederum die Erfahrungen zu machen, die Jesus machte; es geht also um ein dynamisches Wort.
- Die zentrale Rolle der Gerechtigkeit und der Befreiung vom Unrecht
- Die Würde jedes Menschen
- Die führende Rolle der Laien
- Die Bischöfliche Kollegialität
- Die Bedeutung der Lokalkirche
- Die Bedeutung der Basisgemeinden
- Der Geist von Gemeinschaft und Mitbestimmung.
- Die Volksreligiösität als Ausdruck eines inkulturierten Glaubens.
7.3. Fortschritte sollten in folgenden Punkten gemacht werden:
- Die Kirche stärker in den Dienst des Reiches Gottes und nicht der Verteidigung ihrer Institution bzw. ihrer historisch gewachsenen Privilegien stellen.
- Die Armen, die Opfer des Systems, besser annehmen, ihnen Raum geben, indem die Ausgeschlossenen – die Indígenas, Afros und Frauen – in der Kirche mitbestimmen können.
- Die Dankbarkeit für das Geschenk der Existenz leben.
- Mutiger die Ämterfrage in der Kirche behandeln, vor allem um die Eucharistiegemeinschaft zu sichern.
- Unter Respektierung von Verschiedenheit und Pluralität im ökumenischen und interreligiösen Dialog vorankommen.
- Den Prozessen einer organischen Pastoral Vorrang geben.
- Der Ökologie größere Aufmerksamkeit schenken im Hinblick auf den Beitrag, den die Kirche hier leisten kann.
8. Was jedoch gefordert werden kann
In dem Bewusstsein, dass nicht alle Erwartungen an die Konferenz in Aparecida umgehend behandelt oder in ihrem offiziellen Dokument bestätigt werden können, sollen einige als besonders dringlich hervorgehoben werden, damit sie zu Verpflichtungen werden, denen die Konferenz nicht ausweichen kann.
8.1. Basisgemeinden
Die konkreten Gemeinschaften in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit wollen in erster Linie in ihrer Kirchlichkeit anerkannt werden, in der Freiheit das Evangelium leben und auf die Gnadenmittel Gottes zählen können.
8.2. Ämterfrage
Sie ist einer der Angelpunkte kirchlicher Erneuerung. Wegen seines hohen Ranges übersteigt dieses Problem die Zuständigkeit der Konferenz von Aparecida. Umso mehr aber muss die Konferenz ein dringliches Zeichen setzen, damit sich die Kirche mutiger dieser Frage stellt.
8.3. Die Frau in der Kirche
Dieser sehr wichtige Punkt, die Anerkennung des Wirkens der Frau in der Kirche, ihrer kirchlichen Bedeutung und des Amtscharakters ihres Handelns sowie ihrer unverzichtbaren Mitwirkung in Leben und Sendung der Kirche bedarf konkreter, wirksamer Fortschritte.
8.4. Theologische Reflexion
Die Wertschätzung der Arbeit der Theologen, ist von größter Bedeutung, da die Kirche dringend eine Reflexion braucht, die ihr hilft, die notwendigen Schritte in unserer Zeit zu tun.
Schlussfolgerung
Das sind einige Erwartungen an die Konferenz von Aparecida, die im Einklang stehen mit dem Jubiläumscharakter, der Wiederaufnahme des bisherigen Weges und der Neubestätigung der Werte.
Ein noch so langes theoretisches Dokument kann diese Erwartungen nicht erfüllen. Und das ist es auch nicht, worauf das einfache Volk wartet. Im Gegenteil: dem historischen Moment, in dem wir leben, entspricht es besser, sich zu den großen pastoralen Optionen zu bekennen, die das Gesamt der Kirche anregen und sie in eine neue pastorale und missionarische Dynamik bringen können.
Weil heute so viele Veränderungen in der Kirche nötig sind und weil nicht alle zu gleicher Zeit realisiert werden können, ist es so wichtig, dass die Konferenz von Aparecida die Richtung weist und die Türen offen lässt für neue Entwicklungen, die sich aus den Optionen ergeben werden, welche die in Aparecida versammelten Bischöfe treffen.
Das erwarten wir!
Übersetzung aus dem Spanischen: Norbert Arntz, Münster