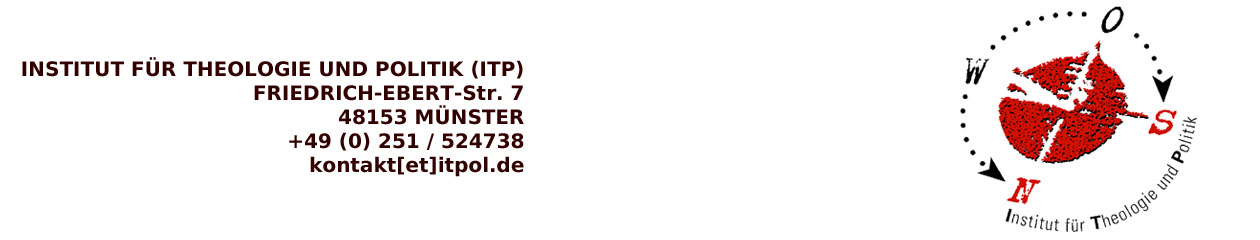Anlässlich des 60. Jahrestages der Katakombenpakts hat das ITP am 16. November 2025 in der Krypta von St. Antonius in Münster zu einem Gottesdienst eingeladen. Der Katakombenpakt war eine der Initialzündungen einer Kirche der Armen und der Befreiungstheologie. Er wurde 1965 von Bischöfen am Rande des II. Vatikanischen Konzils im Jahr in Rom geschlossen und stand für eine neue Anknüpfung an eine Kirche aus den Katakomben aus den ersten drei christlichen Jahrhunderten.
2015 hat das ITP schon einmal dieses Paktes bei einer internationalen Versammlung in Rom gedacht und für seine theologische, ekklesiologische und praktische Erneuerung geworben. Wir haben kleine Heftchen erstellt, mit dem Wortlaut des Katakombenpaktes, die bei uns gerne bestellt werden können (10 Exemplare für 3 Euro). In unserem aktuellen Rundbrief hat Michael Ramminger den Beitrag „Der Katakombenpakt. Eine gefährliche Erinnerung“ veröffentlicht, der hier online nachlesbar ist.
Heute stellt sich die Frage, was von diesem Pakt und seiner Erinnerung geblieben ist. Er könnte eine Provokation dafür sein, dass es zur Katastrophalität unserer Welt doch eine Alternative gibt. Diese Perspektive haben wir versucht in dem Gottesdienst zu eröffnen. Hier dokumentieren wir die Predigt und die liturgischen Texte:
Predigt anlässlich des Gottesdienstes „60 Jahre Katakombenpakt“
von Julia Lis / ITP (16.11.2025, Krypta von St. Antonius, Münster)
Es ist heute genau 60 Jahre her: Am 16. November 1965 schlossen zunächst 40 Bischöfe in der Domitilla-Katakombe einen Pakt. Sie verpflichteten sich darin auf eine arme und dienende Kirche. Dieser Pakt schrieb Geschichte: Er wurde der Startschuss der Befreiungstheologie und einer der wichtigsten Vorläufer der Bischofsversammlung von Medellín, die dazu beitrug, dass für eine kurze Zeit weite Teile der lateinamerikanischen Kirche „immer leuchtender das Gesicht einer wirklich armen, missionarischen und österlichen Kirche [zeigten], losgelöst von aller zeitlichen Macht und mutig engagiert in der Befreiung des ganzen Menschen und aller Menschen“ (Medellín 5.15).
Der Katakombenpakt enthält konkrete Selbstverpflichtungen der Bischöfe in Hinblick auf deren Umgang mit Geld, Kleidung, Immobilien, Titeln – und doch geht seine Bedeutung weit über einen Wandel im Lebensstil Einzelner hinaus. Denn nicht das Verhalten der Bischöfe und deren Lebensweise sind es auf die der Pakt im Letzten abzielte: Es geht um mehr! Nämlich um einen Bruch mit der 1700jährigen Kirchengeschichte und der Rolle, die die Kirche und damit die Bischöfe als deren Vertreter darin spielten. Blicken wir also zurück:
Das heutige Evangelium versetzt uns in die Anfänge der Kirchengeschichte. Die Zeit, in der sich die ChristInnen für ihre Versammlungen verstecken mussten, wirklich oder symbolisch in die Katakomben, die unterirdischen Friedhöfe am Rande der Stadt Roms gingen. Ihre Position war die der Feinde des Römischen Reiches. Denn sie bezogen sich auf jenen Rebellen Jesus, der in der Peripherie des Römischen Reiches gekreuzigt wurde, weil er die Totalität der ökonomischen, politischen und ideologischen Macht dieses Imperiums durch sein Reden und Handeln radikal infrage gestellt hatte. Mit seinem Tode war nicht alles vorbei: So bezeugten es seine Jüngerinnen und Jünger, so glaubten es die, die sich den ersten Gemeinden anschlossen.
Diese ersten christlichen Gemeinden lebten also in dem Bewusstsein, dass sie sich in einem Widerspruch zum herrschenden Imperium befinden – und rechneten, wie es uns das heutige Evangelium vor Augen stellt, daher durchaus auch mit Verfolgung. Sie sahen die Gesetze des Imperiums als ausgesetzt: ob Militärdienst, Kaiserkult, Steuern – all dies galt für sie nicht mehr. Dafür galt bei ihnen eine andere Lebensform der Solidarität, mit denen in der Gemeinde, die arm, versklavt und ausgebeutet waren, eine Logik der Gleichheit und Freiheit aller gegen die Logiken eines Imperiums, das Ungleichheit und Unfreiheit permanent produzierte. Sie wussten zwar, dass sie das Imperium nicht einfach stürzen konnten. Sie hatten aber, so wird es uns in den Paulusbriefen immer wieder eindrücklich vor Augen geführt, die feste Überzeugung, dass mit der Auferstehung Jesu die Macht des Imperiums bereits gebrochen ist. Auch davon berichtet uns das Evangelium: vom apokalyptischen Bewusstsein dieser ersten ChristInnen.
Apokalypse, das ist für viele Menschen heute erst einmal ein bedrückendes, bedrohliches Wort: Weltuntergangsstimmung. Für die ersten ChristInnen aber bedeutete es etwas anderes: die Offenbarung, der Verhältnisse in der Welt wie sie sind, jenseits ihrer ideologischen Verschleierung. Und das Bewusstsein, die frohe Botschaft, dass diese Verhältnisse nicht ewig und gottgegeben sind, sondern auf tönernen Füßen stehen. Diese apokalyptische Überzeugung gab ihnen den Mut ein Leben zu führen als ob nicht: als ob der Kaiser nicht mehr der Herrscher über Leben und Tod sei, als ob die Gesetze nicht mehr gälten.
Eine solche Haltung aber war gefährlich für das Imperium: Sie höhlte dessen ideologische Grundlagen aus, die damals wie heute den Menschen vermitteln, dass die Dinge so sind, wie sie sind und das Streben nach grundsätzlichen, revolutionären Veränderungen nur ins Chaos führen kann, so dass es besser sei, die Machtverhältnisse im Großen und Ganzen zu akzeptieren. Diesem Glauben stellten die ersten ChristInnen ihren Glauben an den Messias Jesus entgegen, der die Verhältnisse nicht akzeptierte, sondern das Kommen ganz andere Verhältnisse verkündete, die bereits im Hier und Jetzt anbrechen: das Reich Gottes.
Diese christliche Botschaft hat mit Kaiser Konstantin das Römische Reich in einem genialen Schachzug zugleich vereinnahmt und entschärft. Kaum wurde das Christentum zu erlaubten Religion wurde es dem Schutz und damit auch der Kontrolle des Imperiums und der in ihm herrschenden Gesetze und Normen unterworfen. Der Gegenkaiser Jesus Christus wurde nun als Pantokrator, Weltenherrscher, verehrt und der Kaiser zu seinem Stellvertreter auf Erden. Die Mächte dieser Erde wurden jetzt legitimiert dadurch, dass Gott und das Reich Gottes in den Himmel und damit ins Jenseits dieser irdischen Verhältnisse verbannt wurden.
Immer wieder haben sich in den nächsten 1700 Jahren Christinnen und Christen gegen diese Auffassung gestemmt, indem sie das Evangelium und seine Botschaft neu entdeckten: Franz und Klara von Assisi, Thomas Müntzer, die TäuferInnen, Bartolomé de las Casas, um hier nur einige zu nennen.
Der Katakombenpakt, an den wir heute erinnern, aber war nach 1700 Jahren ein ebenso unerwarteter wie revolutionärer Aufruf zum Bruch der Kirche insgesamt mit ihrer Allianz mit den Herrschenden und Mächtigen, die die ganze Kirchengeschichte durchzog. Die Möglichkeit dieses Bruchs wird nur verständlich auf dem Hintergrund der Erfahrung von vielen jungen Frauen und Männern in den Ländern Lateinamerikas, inmitten brutaler Diktaturen. Sie engagierten sich in linken Parteien, Gewerkschaften, sozialen Bewegungen. Sie und mit ihnen die Unterzeichner des Katakombenpaktes und die lateinamerikanischen Bischöfe auf der Versammlung von Medellín brachen mit der jahrhundertelangen Allianz von Thron und Altar. In diesem Sinne hat der Katakombenpakt eine Revolution in der Kirche ausgelöst.
Der Preis für diesen Bruch war hoch: Wie die ersten ChristInnen aus dem heutigen Evangelium riskierten auch viele, die sich der Befreiungstheologie und den Kämpfen und Gerechtigkeit anschlossen, Verfolgung und nicht selten den Tod. Die Theologie der Befreiung wurde bekämpft: von den Diktaturen Lateinamerikas, aber auch von der römischen Kirche.
Der Kampf gegen die Befreiungstheologie hat Spuren hinterlassen: Kaum vorstellbar ist für uns heute, dass eine Umkehr der ganzen Kirche im Sinne des Katakombenpaktes noch gelingen könnte. Obwohl seit der Wahl des Argentiniers Bergoglio nun auch in Rom ein neuer Wind weht. Papst Franziskus und nun auch Papst Leo XIV. mögen sich nicht offen als Befreiungstheologen bezeichnen. In ihrer Kritik an den herrschenden Verhältnissen, an Umweltzerstörung, Kapitalismus und Grenzregimen sowie in ihrer Positionierung an der Seite der Sozialen Bewegungen, haben sie die zentralen Anliegen des Katakombenpaktes aufgegriffen.
Aber was bedeutet das für uns? Hier in Deutschland inmitten einer Kirche, die dem Katakombenpakt wenig abzugewinnen können scheint, ihn gerne vergessen hat – und die Befreiungstheologie als geschichtliches Phänomen betrachtet sehen möchte.
Erinnern im christlichen Sinne heißt nicht einfach einv ergangenes Ereignis ans Licht zu holen. Erinnern heißt vergegenwärtigen. In diesem Sinne haben wir vor 10 Jahren in Rom eine Versammlung organisiert, um den Katakombenpakt zu erinnern und zu erneuern.
In diesem Sinne müssen wir uns auch heute die Frage stellen, was angesichts der Katastrophalität der Welt und der Indifferenz weiter Teile von Kirchen und Gesellschaft für uns heute ein Leben in der Nachfolge des Evangeliums bedeuten kann. Vielleicht meint es neu zu verstehen, was eine Kirche aus den Katakomben heute sein könnte: Wie wir Gemeinschaften und Lebensformen organisieren können, die etwas vom als-ob nicht der ersten ChristInnen aufscheinen lassen: so zu leben, als ob die Verhältnisse nicht auf ewig besiegelt wären, nicht Krieg, Zerstörung der Welt und der Menschen das letzte Wort hätten. Als ob das Gesetz nicht mehr gälte.
So werden wir sicher angesichts der kirchlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse keine Massenbewegung. Aber vielleicht gelingt es uns im Suchen nach einer messianisch-apokalyptischen Lebensform für heute etwas von jenem Aufbruch zu vergegenwärtigen und weiterzutragen für den der Katakombenpakt einst stand.
Liturgische Texte aus dem Gottesdienst
Kyrie:
Herr Jesus, die Gekreuzigten unserer Welt sind die Verarmten, die Opfer eines ausbeuterischen Systems. Wie dein Kreuz sind sie ein Schrei nach einer anderen Welt.
Kyrie, kyrie eleison.
Herr Jesus, deine Auferstehung ist die Rebellion des Lebens gegen den Tod und seine Komplizen in dieser Welt. Die Aufstände, die in unseren Tagen weiterhin von den Peripherien ausbrechen, sind für uns Zeichen der Hoffnung, die dein Reich der Gerechtigkeit ankündigen.
Christe, christe eleison.
Herr Jesus, dein Geist will die Kirche beleben. Du hast uns den Auftrag gegeben, für eine neue Welt zu kämpfen, in der ein Leben in Fülle für alle deine Geschöpfe möglich ist.
Kyrie, kyrie eleison.
(dieser Text wurde bereits für den Gottesdienst in der Domitilla-Katakombe aus Anlass des 50. Jubiläums 2015 von uns verfasst)
Gebet
Gott des Lebens, du rufst uns in die Nachfolge des Messias Jesus, der denen das Reich der Gerechtigkeit angekündigt hat, die auf der Rückseite der Geschichte stehen. Schenke uns den Geist, der auch im Katakombenpakt atmet, uns auszustrecken nach deinem Reich – auf dass diese Zeit endlich ein Ende hat und ein Leben in Fülle für alle anbricht. Darum bitten wir, durch Christus, den Messias.
Fürbitten
Der Katakombenpakt vor 60 Jahren wollte einen Impuls setzen „für eine dienende und arme Kirche“. Auf Gott, der parteiisch auf der Seite der Armen steht, haben sie ihr Vertrauen gesetzt bei ihrem Versprechen. Diesen Gott, der die Sonne der Gerechtigkeit ist und bei dem wir Heilung erfahren, wollen wir in den Fürbitten beten:
1. Im Katakombenpakt heißt es: „Alle Laien, Ordensleute, Diakone und Priester, die der Herr dazu ruft, ihr Leben und ihre Arbeit mit den Armgehaltenen und Arbeitern zu teilen und so das Evangelium zu verkünden, werden wir unterstützen.“ Wir bitten für alle, die im apostolischen Einsatz das Gottesreich des Friedens und der Gerechtigkeit verkünden und den Armen die frohe Botschaft verkünden, dass ein neues Leben anbricht. Um Mut und Furchtlosigkeit angesichts aller Repression und effektive Liebe zu allen Menschen. Wir rufen zu dir:
2. Im Katakombenpakt heißt es: „Wir verzichten ein für allemal darauf, als Reiche zu erscheinen wie auch wirklich reich zu sein.“ Wir bitten um die Bekehrung der Reichen, die von Gott oft so weit entfernt sind, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als das ein Reicher in das Reich Gottes eingeht. Um Barmherzigkeit und Schritte auf dem Weg der gutes Leben für alle sucht. Wir rufen zu dir:
3. Im Katakombenpakt heißt es: „Wir werden in unserem verhalten und in unseren gesellschaftlichen Beziehungen jeden Eindruck vermeiden, der den Anschein erwecken könnte, wir würden Reiche und Mächtige privilegiert, vorrangig oder bevorzugt behandeln.“ Wir bitten um eine große Klarheit und Abstand der Kirche zu den staatlichen Stellen, besonders zum Militär und Polizeiapparat in allen Staaten. Um Entschiedenheit und Kraft für den Frieden Christi zu optieren in einer Welt, die immer weiter in den 3. Weltkrieg in Stücken, in Aufrüstung und Kriegsregime versinkt. Wir rufen zu dir:
4. Im Katakombenpakt heißt es: „Wir werden uns bemühen, so zu leben, wie die Menschen um uns her üblicherweise leben, im Hinblick auf Wohnung, Essen, Verkehrsmittel und allem, was sich daraus ergibt.“ Wir bitten dich für die Umkehr der Kirche in unserem Land, die immer noch materiell reich ist. Um die Einsicht, dass die arm Gemachten die bevorzugte Quelle der Offenbarung von Gottes gutem Heilswillen für alle Menschen sind, und dass ein einziger Armer, der an Gottes rettenden Eingriff in die Geschichte glaubt, mehr wert ist als jeder Palast oder prunkvolle Kirche. Wir rufen zu dir:
Der Katakombenpakt schließt mit den Worten: „Gott helfe uns, unseren Vorsätzen treu zu bleiben“. Alle sind gerufen eine arme Kirche der Armen zu bilden. Gottes Reichtum übersteigt die Reichtümer hier bei weitem durch ein einfaches und geteiltes Leben, wie es im gebrochenen Brot sichtbar wird. Alle Bitten nehmen wir mit hinein in die Gabenbereitung und preisen Gott, heute, jeden Tag und in Ewigkeit. Amen
Gebet
Guter Gott, du erneuerst deine Kirche aus dem Geist des Evangeliums und des Reiches Gottes. Wir danken dir für den Katakombenpakt, die Kirche von Medellín und die vielen Frauen und Männer, die mutig im Geiste der Theologie der Befreiung lebten und handelten. Viele von ihnen haben dafür ihr Leben gegeben.
Wir bitten dich stärke auch uns mit deinem Geist der Nachfolge des Messiais Jesus, damit wir eine Kirche sind und werden, die sich gegen die herrschenden Verhältnisse stellt. Lass uns im Geiste Medellins eine wirklich arme, missionarische und österliche Kirche werden, losgelöst von aller zeitlichen Macht und mutig engagiert in der Befreiung des ganzen Menschen und aller Menschen (Medellín 5.15). Amen.