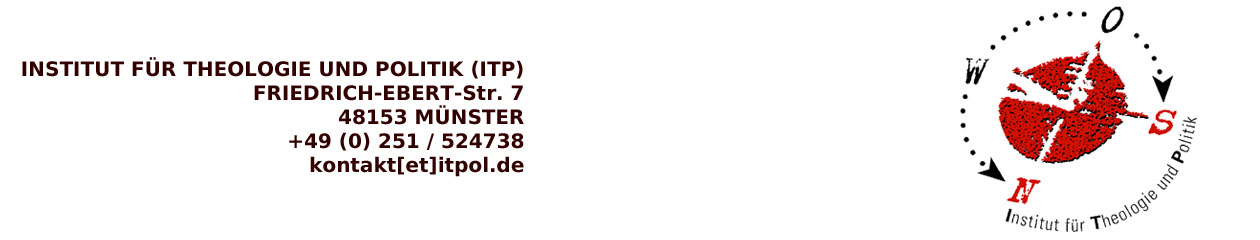Weltsozialforum 2007 Nairobi/Kenia
Michael Ramminger/ Katja Strobel – Institut für Theologie und Politik
 Das diesjährige Weltsozialforum 2007 hat sich zum erstenmal in Afrika getroffen. Dies war sicherlich ein wichtiges Zeichen: Vor allem für die Kenianer schuf es die Möglichkeit, ihre Probleme und Kämpfe in der eigenen nationalen Öffentlichkeit bekannt zu machen und ihre Postionen zu stärken, für die Lateinamerikaner und die Europäer war es die Möglichkeit, die Diskrepanz zwischen massenmedial vermittelten Katastrophenbildern und der Wirklichkeit afrikanischen Alltags sinnlich zu ergreifen. So sagte der salvadorenische Befreiungstheologe Jon Sobrino, der sicherlich einiges in seinem Leben gesehen hat bei einem Besuch in einem Slum,: „Ich verneige mich vor dem Leid und der Hoffnung der Menschen von Nairobi.“ Zu Recht wurde das Forum von einer Demonstration von einem der grösssten Slums von Nairobi, Kibera, aus eröffnet und mit einem Demonstrationszug durch vierzehn weitere Slums zur Abschlussveranstaltung hin beendet.
Das diesjährige Weltsozialforum 2007 hat sich zum erstenmal in Afrika getroffen. Dies war sicherlich ein wichtiges Zeichen: Vor allem für die Kenianer schuf es die Möglichkeit, ihre Probleme und Kämpfe in der eigenen nationalen Öffentlichkeit bekannt zu machen und ihre Postionen zu stärken, für die Lateinamerikaner und die Europäer war es die Möglichkeit, die Diskrepanz zwischen massenmedial vermittelten Katastrophenbildern und der Wirklichkeit afrikanischen Alltags sinnlich zu ergreifen. So sagte der salvadorenische Befreiungstheologe Jon Sobrino, der sicherlich einiges in seinem Leben gesehen hat bei einem Besuch in einem Slum,: „Ich verneige mich vor dem Leid und der Hoffnung der Menschen von Nairobi.“ Zu Recht wurde das Forum von einer Demonstration von einem der grösssten Slums von Nairobi, Kibera, aus eröffnet und mit einem Demonstrationszug durch vierzehn weitere Slums zur Abschlussveranstaltung hin beendet.
Probleme in Kenia
Allerdings waren mit diesem Austragungsort auch Schwierigkeiten und Eigenarten verbunden, die eine Einschätzung des WSF erschweren. Die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, traten in der Organisation sehr deutlich zu Tage: Es war nur schwer möglich, das Forum zu finanzieren. Eine wichtige Säule, wie in Porto Alegre die Kommune, fiel weg, Nairobi stellte nur politische und infrastrukturelle (Gebäude, Sicherheitspersonal), aber keine finanziellen Ressourcen bereit.
Korruption und Eigeninteressen im nationalen Vorbereitungskomitee wurden deutlich: Das einzige Restaurant, das auf dem Gelände des WSF seine Zelte aufstellen durfte, „Windsor“, gehörte dem Minister für innere Sicherheit, der außer als Besitzer eines Nobelrestaurants auch als Folterer nach dem Mau Mau – Aufstand bekannt ist. Das Restaurant des Ministers wurde am letzten Tag gestürmt und das Essen kostenlos verteilt. Die Preise dort waren noch einmal doppelt so teuer wie die der anderen Anbieter, deren aber auch noch drei mal so hoch wie die in der Stadt, die sich KenianerInnen hätten leisten können. Das betrifft auch den Wasserverkauf im Stadion. Dessen 2-3fache Einnahmen sackten große Firmen ein – erst am vorletzten Tag wurden die Tore für KenianerInnen aufgemacht, so dass auch informelle HändlerInnen verkaufen konnten, was sich sofort im Preisniveau niederschlug.
Bis dahin aber gab es jeden Tag Proteste des People’s Parliament, das sich seit 1992 in Nairobi trifft, und das eine Art Gegenveranstaltung in der Stadt in den Jevanjee Gardens abhielt, offen ohne Eintritt und mit weniger Fahrtkosten verbunden. Die Eintrittsgebühr in das Stadion außerhalb der Stadt, wo das WSF tagte, sollte für KenianerInnen 500 KSh betragen, ca. 5 Euro – wobei dies ungefähr der Monatsmiete einer Hütte in einem Slum entspricht. Nach mehreren Tagen Protest, der Stürmung einer Pressekonferenz und dem Niederreißen eines Tores wurde das Stadion für KenianerInnen freigegeben, was sich deutlich auch daran zeigte, dass fortan der informelle „privatwirtschaftliche“ Sektor den Kunsthandwerkständen der NGOs Konkurrenz machte.
Unbehelligt blieben die zahlreichen Celtel-Kioske des kenianischen Handy-Anbieters, der das WSF sponsorte. Er monopolisierte nicht nur Telefon- und Handy-Dienste im Stadion, sondern ließ sich auch die nachträgliche Bezahlung für die Registrierung mit einer Gebühr von 2000 KSh (20 Euro) bezahlen.
Telefon- und Handy-Dienste im Stadion, sondern ließ sich auch die nachträgliche Bezahlung für die Registrierung mit einer Gebühr von 2000 KSh (20 Euro) bezahlen.
Fast unbemerkt blieb diesmal das Jugendcamp. Erst im Nachhinein war zu erfahren, dass dort kaum ein Drittel der Zelte belegt war, weil die Jugendlichen sich zu ganz normalen Eintrittspreisen registrieren lassen mussten. Ein letztes Beispiel für die Diskriminierung/ das Ausschließen von afrikanischen TeilnehmerInnen war das Aufhalten einer Buskarawane an der Grenze zu Tansania. Vor allem Busse aus Südafrika waren vier Tage nach Kenia unterwegs und mussten dann an der Grenze ihre Fahrzeuge zurücklassen, weil sie einen Zoll in Höhe des Fahrzeugwertes hätten zahlen müssen– die Regierung begründete das mit der Sorge, die Busse könnten im Land verkauft werden. Die TeilnehmerInnen mussten sich irgendwie anders nach Nairobi durchschlagen.
Ein Vertreter des Kenianischen Sozialforum berichtete am letzten Tag des WSF auf der Versammlung der Sozialen Bewegungen, dass es um diese Dinge innerhalb des Organisationskomitees im Vorhinein Konflikte gegeben hätte, die aber nicht hätten gelöst werden können, und bedankte sich für die Unterstützung gegen die Kommerzialisierung, Privatisierung und Militarisierung des WSF. Vor allem die Delegierten des Antiprivatisierungsforums aus Südafrika hatten die Proteste unterstützt.
[MEDIA=1]
WSF: nur halbsoviel TeilnehmerInnen wie die vergangenen Jahre
Insgesamt nahmen am WSF ca. 40-50.000 Menschen teil, also weit weniger als die Hälfte der erwarteten TeilnehmerInnen. Zudem gab es eine überstarke Präsenz von afrikanischen und kirchlichen Nichtregierungsorganisationen; Bewegungen und bewegungstypische Themen prägten dieses WSF kaum. Stattdessen gab es eine Vielzahl von Veranstaltungen zu Ernährungssicherheit, Gesundheit, Wasser, HIV/Aids und natürlich zur Landfrage.
Und hier sind wir bereits mitten in den Schwierigkeiten der Einschätzungen dieses WSF: Ist die Tatsache des Eindrucks der Übermacht der NGOs der geringen TeilnehmerInnenzahl geschuldet? Und wenn ja, warum waren es nur noch die Hälfte der vorangegangen Jahre? Ein Argument ist sicherlich, dass in Ost- und Westafrika, wie es so schön heißt, die Ausbildung der Zivilgesellschaft relativ schwach ist, d.h. dass es nicht allzu viel und starke soziale Bewegungen nach südafrikanischem, lateinamerikanischem oder indischem Muster gibt. Denn von der starken Präsenz regionaler Bewegungen hatten die bisherigen Foren ja immer gehörig profitiert. Jenseits dessen fehlten aber auch viele Bewegungen aus Lateinamerika und Europa. Oder ist es dem fehlenden Interesse an Afrika oder der nachlassenden Dynamik der „Bewegung der Bewegungen“ geschuldet?
Afrika und internationale Solidarität
Auffällig war auf jeden Fall, dass das Phänomen „Transnationalität“, Fragen internationaler Solidarität und globaler Gegenstrategien kaum auftauchten. Zwar gab es bei konkreten Kampagnen wichtige Fortschritte. Z.B. in der Gründung des Wasser-Netzwerks, einem Zusammenschluss von Kampagnen gegen Wasserprivatisierung, in dem nun auch afrikanische Organisationen stark vertreten sind und ähnlichen Zusammenschlüssen in den Bereichen Nahrungssicherheit/ Recht auf Nahrung oder Landfrage. Diese Veranstaltungen waren aber mehrheitlich von AfrikanerInnen besucht, bei Landfragen spielten lateinamerikanische GenossInnen von Via Campesina noch eine Rolle. Und es gab Proteste gegen die Freihandelsabkommen EPA.
Dagegen waren Veranstaltungen, die Strategiefragen, transnationale Solidarität von ArbeiterInnen oder die Zukunft des WSF zum Thema hatten, ganz überwiegend von EuropäerInnen und LateinamerikanerInnen besucht. Auf Nachfragen argumentierten die AfrikanerInnen meist höflich, dass diese Foren lediglich für Weiße etwas brächten und man selbst mit anderen existentiellen Fragen und der unmittelbaren Verbesserung der Lebensumstände beschäftigt sei. Wenn überhaupt von internationaler Solidarität die Rede war, dann in der Achse Afrika – Asien – Lateinamerika.
Vergiss Europa
Wie auch immer man das einschätzt: Deutlich wurde auf jeden Fall, dass von Europa insgesamt nicht viel, oder vielleicht sogar nichts mehr erwartet wird. Und das schliesst auch die BewegungsverteterInnen mit ein. Europa spielte eine zu vernachlässigende Rolle. Aufmerksamkeit erregte allein der Podiumsbeitrag eines Italieners auf dem Eröffnungspodium, der  sich dort als mitverantwortlich für die Ausbeutung Afrikas durch den Kolonialismus und die fortgesetzte Wirtschafts- und Entwicklungspolitik bezeichnete und um Vergebung bat. Das gleiche Thema wurde auf der dritten Veranstaltung zum G8 angeschnitten, die vom deutschen G8-Bündnis und maßgeblich dem eed vorbereitet worden war. Im Vergleich zur vorangegegangenen Veranstaltung zum gleichen Thema fanden sich hier zwar einige AfrikanerInnen ein. Ihre Fragen wurden aber in beschämender Weise ignoriert: Sie forderten konkrete Antworten auf ihre Situation ein: Beschäftigen sich die ProtestlerInnen in Deutschland mit dem Thema Kolonialismus? Was tut ihr, um unsere beschissene Situation hier zu verbessern? Wir sind müde! Wie kann ich hier vor Ort die G8 blockieren? – Die PodiumsteilnehmerInnen hatten sich – statt auf solche Fragen – auf Mobilisierungsprobleme vor Ort beschränkt, und die Frage nach internationaler Beteiligung hilflos ans Publikum abgegeben. Nachdem ca. 5 Menschen die jeweilige Perspektive auf die Proteste geschildert hatten, eröffnete die Moderatorin mit den Worten die Diskussion: „Wir haben ja auch einige AfrikanerInnen hier, vielleicht könnten sie uns sagen, wie wir die internationale Beteiligung besser gewährleisten können, bzw. welche Themen für sie wichtig wären, um sie bei den Protesten mit einzubringen.“
sich dort als mitverantwortlich für die Ausbeutung Afrikas durch den Kolonialismus und die fortgesetzte Wirtschafts- und Entwicklungspolitik bezeichnete und um Vergebung bat. Das gleiche Thema wurde auf der dritten Veranstaltung zum G8 angeschnitten, die vom deutschen G8-Bündnis und maßgeblich dem eed vorbereitet worden war. Im Vergleich zur vorangegegangenen Veranstaltung zum gleichen Thema fanden sich hier zwar einige AfrikanerInnen ein. Ihre Fragen wurden aber in beschämender Weise ignoriert: Sie forderten konkrete Antworten auf ihre Situation ein: Beschäftigen sich die ProtestlerInnen in Deutschland mit dem Thema Kolonialismus? Was tut ihr, um unsere beschissene Situation hier zu verbessern? Wir sind müde! Wie kann ich hier vor Ort die G8 blockieren? – Die PodiumsteilnehmerInnen hatten sich – statt auf solche Fragen – auf Mobilisierungsprobleme vor Ort beschränkt, und die Frage nach internationaler Beteiligung hilflos ans Publikum abgegeben. Nachdem ca. 5 Menschen die jeweilige Perspektive auf die Proteste geschildert hatten, eröffnete die Moderatorin mit den Worten die Diskussion: „Wir haben ja auch einige AfrikanerInnen hier, vielleicht könnten sie uns sagen, wie wir die internationale Beteiligung besser gewährleisten können, bzw. welche Themen für sie wichtig wären, um sie bei den Protesten mit einzubringen.“
Strategisches und Konkretes
Sagen wirs klar: Die Aufgabenverteilung bestand darin, dass EuropäerInnen, evtl. noch LateinamerikanerInnen, große Strategiefragen stellten (bitte nicht verwechseln mit Systemfrage!), also Fragen nach internationalen Finanzmärkten, Flugbenzinbesteuerung, WTO und Weltbank etc.) während die AfrikanerInnen und die NGOs nach Essen, Land und Wasser fragten. Dies bedeutet beileibe nicht, dass sich alle Hoffnung auf kleine Verbesserungen und vielleicht sogar auf NGOs stützen. Es bedeutet u..E. vielmehr, dass sich Europa, seine NGOs, nicht zuletzt aber auch die europäische Linke die Frage gefallen lassen muss, ob sie auf der Suche nach einer anderen möglichen Welt den dazu nötigen „transnationalen Ernst“ aufbringen. Oder anders herum: Wir sollten endlich aufhören, transnationale oder internationale Solidarität vom Norden her zu definieren versuchen und begreifen, dass solche Strategiesuche nur unter ernsthafter Einbeziehung von Menschen und Bewegungen aus Afrika, Lateinamerika und Asien und ihrer Einschätzung der Welt funktionieren kann.
Die einfache Gleichung NGO=systemimmanent und -reproduzierend und Bewegungen=politisch, systemüberwindend, antikapitalistisch und anti-neoliberal ist jedenfalls gerade vor dem Hintergrund der afrikanischen Verhältnisse, hier Kenia und Nairobi zu einfach. Sie dürfte eher wiederum einer europäischen/bundesdeutschen Projektion entspringen, als dass sie analytisch weiterbringt: „Was haben Eure Proteste mit unseren Problemen zu tun?“ lautete die Frage an die G8-Protestler, auf die es kaum mehr als hilflose Antworten gab. Natürlich haben unsere Proteste viel mit diesen Problemen zu tun, aber wenn wir das nicht spontan vermitteln können, stellt sich die Frage, mit wessen Augen wir auf die Welt schauen.
Ganz falsch ist die obige Gleichung übrigens doch wieder nicht: Als der eed-Kollege ein flammendes Plädoyer für den Dialog und die Lobbyarbeit hielt, was immer eine „zeitaufwändige und langfristige“ Angelegenheit sei, fiel ihm der Selbstwiderspruch gar nicht mehr auf, als er kurz darauf erwähnte, dass wir angesichts der dramatischen Verhältnisse in Afrika keine Zeit mehr hätten. Im Zelt klangen da noch die einleitenden Worte zweier Jugendlicher nach, die in Einleitung zu ihrem vorgetragenen Anti-G8-Song sagten: „We fight the system, do you know what that is?“ Und andererseits wurden durch verschiedene afrikanisch/lateinamerikanische Veranstaltungen hindurch immer wieder die lateinamerikanischen Wahlerfolge gegen die neoliberalen Regierungen und Regime in Bolivien, Venezuela, aber auch Ecuador, Nicaragua und Argentinien als erfolgreiche Beispiele und Kämpfe von sozialen Bewegungen erwähnt und zum Teil sogar als Erfolge der WSF-Bewegung diskutiert.
Wie weiter, oder: das Ende der Multitude
Der antineoliberale, vielleicht sogar antikapitalistische Geist und der Wille zu weltweiten gemeinsamen Kämpfen wehte am ehesten noch auf der Weltversammlung der sozialen Bewegungen am letzten Tag des WSF, in der dort laut gewordenen Kritik an Kommerzialisierung, Privatisierung und Militarisierung des Weltsozialforums und der Forderung, sich das WSF von den NGOs zurückzuerobern. Allerdings waren die Möglichkeiten, diesen Kampf voranzutreiben, auf den vorangegangenen Tagen viel zu wenig genutzt. Es blieb eher der schale Geschmack nicht vorwärtsbringender, wenn auch nicht falscher Parolen, eher das Gefühl eines Rückfalls hinter gewonnene praktische und theoretische Konvergenzen.
Der Weg des WSF zu einem Fachforum der Nichtregierungsorganisationen ist nicht auszuschließen. Diese Gefahr ist nicht zuletzt dadurch auszuschließen, dass von den OrganisatorInnen das Prinzip der Vielfalt bis auf ein Maß strapaziert wurde, dass jede inhaltliche Focussierung verunmöglichte[1]. Vermutlich war es das erste WSF, auf dem AbtreibungsgegnerInnen öffentlich demonstriert haben. Der globale Kapitalismus kennt nur einen wirklichen Feind, wie Alain Badiou sagt: ein anderes universales Projekt, und weder die undefinierte Multitude noch die projektzentrierte NGO ist ihm sicherlich ein ernster Gegner. Damit ist nicht das Prinzip der unkontrollierbaren, kreativen Vielfalt negiert. Aber wo es zum Dogma erhoben wird, ist es auch keine Vielfalt mehr. Und unter dem Verdikt der Pluralität wird eben zugleich auch jede Konfrontation und schlußendlich auch Annäherung verhindert. Und es macht nicht zuletzt auch die Notwendigkeit, sich der „Erfahrung“, des „Lebens“ der Anderen existentiell anzunähern, zunichte. Die Multitude darf nicht zur Beliebigkeit verkommen, auch sie bedarf der Abgrenzung, Eingrenzung und Bestimmung. Die Krise des Neoliberalismus hätte als großer Erfolg gefeiert werden können und zur Suche nach neuen Positionierungen globaler Kämpfe genutzt werden müssen. Diese Chance ist unter anderm unter dem Verdikt der Pluralität vertan worden. Im nächsten Jahr gibt es statt des WSF globale Aktionstage. Es könnte das Ende des WSF bedeuten. Das Ende global vernetzter und artikulierter Kämpfe aber darf es nicht bedeuten.