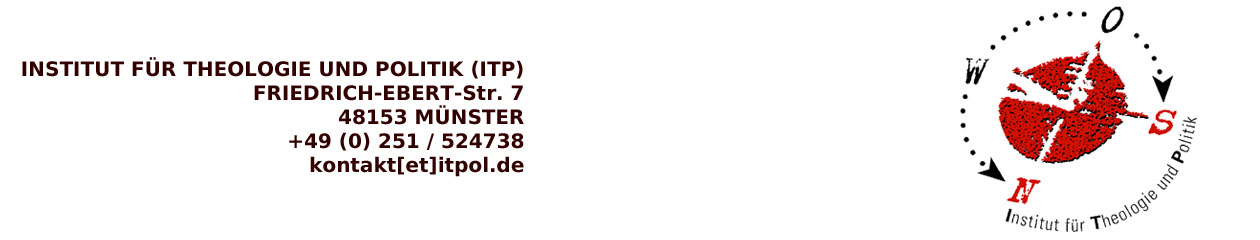Am 23. Oktober 2025 fand im Vatikan, in der Aula Paul VI., ein Treffen von VertreterInnen Sozialer Bewegungen mit Papst Leo XIV. statt. Auch das Institut für Theologie und Politik konnte daran teilnehmen. Wir dokumentieren im Folgenden unsere Übersetzung der Rede des Papstes, die aus unserer Sicht ein wichtiger nächster Baustein der Verbindung von Kirche und Bewegungen auch im neuen Pontifikat ist. Papst Leo hat hier deutlich Position bezogen und Gespür für die sich verändernden globalen Herrschaftsverhältnisse gezeigt. Unser Kommentar ist hier nachlesbar.
Am 23. Oktober 2025 fand im Vatikan, in der Aula Paul VI., ein Treffen von VertreterInnen Sozialer Bewegungen mit Papst Leo XIV. statt. Auch das Institut für Theologie und Politik konnte daran teilnehmen. Wir dokumentieren im Folgenden unsere Übersetzung der Rede des Papstes, die aus unserer Sicht ein wichtiger nächster Baustein der Verbindung von Kirche und Bewegungen auch im neuen Pontifikat ist. Papst Leo hat hier deutlich Position bezogen und Gespür für die sich verändernden globalen Herrschaftsverhältnisse gezeigt. Unser Kommentar ist hier nachlesbar.
Liebe Brüder und Schwestern,
es ist das erste Mal, dass ich die Freude habe, Euch zu begegnen, und damit den Weg fortzusetzen, den Papst Franziskus eingeschlagen hat. Er hat in den letzten Jahren oft mit Euch im Dialog gestanden und Eure prophetische Bedeutung betont in einer Welt, die von Problemen verschiedener Art geprägt ist.
Eines der Motive, das mich bewogen hat, den Namen „Leo XIV.“ zu wählen, ist die Enzyklika Rerum novarum, die Leo XIII. während der industriellen Revolution verfasste. Der Titel Rerum novarum bedeutet „neue Dinge“. Es gibt sicherlich „neue Dinge” in der Welt, aber wenn wir davon sprechen, nehmen wir in der Regel die Perspektive „des Zentrums ” ein und beziehen uns auf so etwas wie künstliche Intelligenz oder Robotik. Heute möchte ich jedoch mit Euch gemeinsam „von der Peripherie aus“ die „neuen Dinge” betrachten.
Die „neuen Dinge“ von der Peripherie aus betrachten
Vor mehr als zehn Jahren sagte Papst Franziskus hier im Vatikan zu Euch, dass Ihr gekommen seid, um ein Banner zu hissen. Was stand darauf geschrieben? „Land, Wohnung und Arbeit”. [1] „Tierra, techo, trabajo”, wie Guadalupe uns gerade gesagt hat. Das war etwas „Neues” für die Kirche, und es war etwas Gutes! Im Einklang mit den Forderungen von Franziskus sage ich Euch heute: Land, Wohnung und Arbeit sind heilige Rechte. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen, und ich will, dass Ihr mich sagen hört: ‚Ich bin dabei! Ich stehe an Eurer Seite!‘
Land, Wohnung und Arbeit für Ausgegrenzte zu fordern — ist das etwas „Neues? Von den Machtzentren der Welt aus betrachtet sicherlich nicht. Wer wirtschaftlich abgesichert ist und ein komfortables Zuhause hat, mag diese Forderungen als etwas überholt betrachten. Wirklich „neu“ scheinen autonome Fahrzeuge, die neuesten Modeartikel oder Kleidungsstücke, Mobiltelefone von höchster Qualität, Kryptowährungen und ähnliche Erfindungen zu sein.
Von der Peripherie aus betrachtet sieht die Welt jedoch anders aus; das Banner, das ihr hochhaltet, ist so aktuell, dass es ein ganzes Kapitel in der christlichen Soziallehre über die Ausgegrenzten in der heutigen Welt verdient.
Diese Perspektive möchte ich betonen: Betrachtet die neuen Dinge aus der Sicht der Peripherie und freut Euch an einem Engagement, das sich nicht auf Protest beschränkt, sondern nach Lösungen sucht. Die Peripherien verlangen Gerechtigkeit, und Ihr schreit nicht „aus Verzweiflung“, sondern „aus Sehnsucht“: Euer Schrei verlangt nach Lösungen in einer von ungerechten Systemen dominierten Gesellschaft. Und Ihr macht das nicht mit Mikroprozessoren oder Biotechnologien, sondern auf ganz elementare Weise, mit der Schönheit handwerklicher Arbeit. Eben das ist Poesie: Ihr seid „soziale Poeten“. [2]
Heute tragt ihr erneut das Banner “Land – Wohnung – Arbeit“ und macht Euch gemeinsam von einem Sozialen Zentrum – vom „Spin Time“ – auf den Weg zum Vatikan. Dieses gemeinsame Gehen bezeugt, dass die Sozialen Bewegungen als schöpferische Kräfte von Solidarität in der Vielfalt immer noch vital sind.
Die Kirche muss an Eurer Seite gehen: eine arme Kirche für die Armen, eine Kirche, die auf die Menschen zugeht, die Risiken wagt, die mutig, prophetisch und dabei noch fröhlich ist!
Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass euer Dienst von Liebe beseelt ist. Ich kenne ähnliche Realitäten und Erfahrungen in anderen Ländern, echte Gemeinschaftsräume voller Glauben, Hoffnung und vor allem Liebe; sie ist stets die wichtigste von allen Tugenden (vgl. 1 Kor 13,13). In der Tat: Wenn wir Genossenschaften und Arbeitsgruppen gründen, um die Hungrigen zu speisen, den Obdachlosen Unterkunft zu geben, Schiffbrüchigen zu helfen, Kinder zu betreuen, Arbeitsplätze zu schaffen, Zugang zu Land zu erhalten und Häuser zu bauen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir keine Ideologie betreiben, sondern wirklich das Evangelium leben.
Im Zentrum des Evangeliums steht nämlich das Gebot der Liebe, und Jesus hat uns gesagt, dass sich in den Gesichtern und Wunden der Armen sein eigenes Gesicht verbirgt (vgl. Mt 25,34-40). Es ist schön zu sehen, dass die Sozialen Bewegungen über jede Art von Individualismus und Vorurteil hinaus entschiedener von der Sehnsucht nach Liebe als vom Verlangen nach Gerechtigkeit angetrieben werden.
Als Bischof in Peru hatte ich das Glück, eine Kirche erlebt zu haben, die die Menschen in ihrem Leid, in ihrer Freude, in ihren Kämpfen und in ihren Hoffnungen begleitet. Das ist ein Gegenmittel gegen die sich ausbreitende strukturelle Gleichgültigkeit, die das Drama der beraubten, ausgeraubten, geplünderten und in Armut gezwungenen Völker ignoriert.
Oft fühlen wir uns angesichts all dessen machtlos, aber wir müssen dem, was ich als „Globalisierung der Ohnmacht” bezeichnet habe, mit einer „Kultur der Versöhnung und des Engagements” entgegenwirken. [3] Die Sozialen Bewegungen füllen die durch den Mangel an Liebe entstandene Lücke mit dem großen Wunder der Solidarität, die auf Nächstenliebe und Versöhnung gründet.
Wie ich bereits sagte, lässt die übliche Diskussion über „neue Dinge” – mit ihrem Potenzial und ihren Gefahren – außer Acht, was an den Rändern geschieht. Im Zentrum gibt es nur ein geringes Bewusstsein für die Probleme der Ausgegrenzten, und wenn in politischen und wirtschaftlichen Debatten über sie gesprochen wird, hat man den Eindruck, „dass ihre Probleme gleichsam als ein Anhängsel angegangen werden, wie eine Frage, die man fast pflichtgemäß oder ganz am Rande anfügt, wenn man sie nicht als bloßen Kollateralschaden betrachtet. Tatsächlich bleiben sie im Moment der konkreten Verwirklichung oft auf dem letzten Platz.“ [4] Im Evangelium dagegen stehen die Armen im Mittelpunkt. Daher sollten sich marginalisierte Gemeinschaften gemeinsam und solidarisch dafür einsetzen, den entmenschlichenden Trend sozialer Ungerechtigkeiten umzukehren und eine ganzheitliche menschliche Entwicklung zu fördern.
Denn in der Tat: „Solange die Probleme der Armen nicht von der Wurzel her gelöst werden, indem man auf die absolute Autonomie der Märkte und der Finanzspekulation verzichtet und die strukturellen Ursachen der Ungleichverteilung der Einkünfte in Angriff nimmt, werden sich die Probleme der Welt nicht lösen und kann letztlich überhaupt kein Problem gelöst werden. Die Ungleichverteilung der Einkünfte ist die Wurzel der sozialen Übel.“ [5]
Alte Ungerechtigkeiten in der neuen Welt
Euer Engagement ist in einer Welt, die, wie wir wissen, immer stärker globalisiert wird, umso notwendiger, wie Benedikt XVI. bekräftigte: „Die angemessen geplanten und ausgeführten Globalisierungsprozesse machen auf weltweiter Ebene eine noch nie dagewesene große Neuverteilung des Reichtums möglich; wenn diese Prozesse jedoch schlecht geführt werden, können sie hingegen zu einer Zunahme der Armut und der Ungleichheit führen sowie mit einer Krise die ganze Welt anstecken.“ [6]
Das bedeutet, dass die Dynamik des Fortschritts immer durch eine Ethik der Verantwortung gesteuert werden muss, wobei die Gefahr der Vergötzung des Profits überwunden und der Mensch und seine ganzheitliche Entwicklung stets in den Mittelpunkt gestellt werden müssen. Im Verständnis des Heiligen Augustinus von einer Ethik der Verantwortung nimmt das „Menschliche” einen zentralen Platz ein. Er lehrt uns, dass Verantwortung, insbesondere gegenüber den Armen und denjenigen, die materielle Not leiden, aus einer menschlichen Haltung gegenüber unseren Mitmenschen entsteht und somit aus der Anerkennung unserer „gemeinsamen Menschlichkeit” [7]
Da wir alle Teil derselben Menschheit sind, müssen wir dafür sorgen, dass „Neuerungen” angemessen gehandhabt werden. Diese Frage darf nicht ausschließlich den politischen, wissenschaftlichen oder akademischen Eliten überlassen bleiben, sondern geht uns alle an. Die Kreativität, mit der Gott die Menschen ausgestattet und die in vielen Bereichen zu großen Fortschritten geführt hat, war noch nicht in der Lage, die Herausforderungen der Armut wirksam anzugehen, so dass es nicht gelungen ist, den Trend zum dramatischen Ausschluss von Millionen von Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, umzukehren. Dies ist ein zentrales Thema in der Debatte über „neue Dinge”.
Als mein Vorgänger Leo XIII. Ende des 19. Jahrhunderts die Enzyklika Rerum novarum verfasste, konzentrierte er sich nicht auf die industrielle Technologie oder neue Energiequellen, sondern vielmehr auf die Situation der Arbeiter. Darin liegt die dem Evangelium entstammende Kraft seiner Botschaft begründet: Im Mittelpunkt stand die Situation der Armen und Unterdrückten jener Zeit. Und zum ersten Mal erklärte ein Papst unzweideutig, dass der tägliche Kampf ums Überleben und um soziale Gerechtigkeit für die Kirche von grundlegender Bedeutung sei. Leo XIII. prangerte die Unterwerfung der Mehrheit unter die Macht „weniger“ an, „bis zu dem Punkt, dass eine äußerst kleine Zahl von Reichen und Wohlhabenden einer unendlichen Menge von Proletariern nichts weniger als das Joch der Sklaverei auferlegt hat.“[8] Das war die große Ungleichheit jener Zeit.
In der Enzyklika von Leo XIII. finden wir die Begriffe „Arbeitslosigkeit” oder „Ausgrenzung” nicht, da sich die Probleme damals eher auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Ausbeutung, die Dringlichkeit einer neuen sozialen Harmonie und eines neuen politischen Gleichgewichts bezogen. Diese Ziele wurden nach und nach durch zahlreiche Arbeitsgesetze und durch die Schaffung von Sozialversicherungsinstitutionen erreicht. Heute hingegen ist Ausgrenzung zum neuen Gesicht sozialer Ungerechtigkeit geworden. Die Kluft zwischen einer „kleinen Minderheit“ – 1 % der Bevölkerung – und der überwiegenden Mehrheit hat sich dramatisch vergrößert.
Diese Ausgrenzung ist eine „Neuerung”, die Papst Franziskus als „Wegwerfkultur” angeprangert hat, indem er vehement erklärte: „Die Ausgeschlossenen sind nicht ’Ausgebeutete‘ sondern Müll, ‘Abfall‘“. [9]
Wenn wir über Ausgrenzung sprechen, stehen wir auch vor einem Paradox. Der Mangel an Land, Nahrungsmitteln, Wohnraum und menschenwürdiger Arbeit koexistiert mit dem Zugang zu neuen Technologien, die sich durch die globalisierten Märkte überall verbreiten. Mobiltelefone, soziale Netzwerke und sogar künstliche Intelligenz sind für Millionen von Menschen zugänglich, auch für jene, die in Armut leben. Doch obwohl immer mehr Menschen Zugang zum Internet haben, bleiben die Grundbedürfnisse weiterhin unerfüllt. Wir müssen sicherstellen, dass wir bei der Befriedigung anspruchsvollerer Bedürfnisse die grundlegenden Bedürfnisse nicht vernachlässigen.
Diese systemische Willkür führt dazu, dass man den Menschen das Nötigste vorenthält, während sie mit Nebensächlichkeiten überschüttet werden. Kurz gesagt, Misswirtschaft unter dem Vorwand des Fortschritts erzeugt und verstärkt Ungleichheiten. Und da die Menschenwürde nicht im Mittelpunkt steht, versagt das System auch in Bezug auf Gerechtigkeit.
Die Auswirkungen der „Neuerungen” auf die Ausgegrenzten
Ich werde heute nicht ausführlich beschreiben, welche „Neuerungen” insbesondere von den technologischen Entwicklungszentren hervorgebracht werden, aber wir wissen, dass sie sich auf alle wichtigen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens auswirken: auf Gesundheit, Bildung, Arbeit, Verkehr, Stadtplanung, Kommunikation, Sicherheit, Verteidigung usw. Viele dieser Auswirkungen sind ambivalent: Für einige Länder und soziale Sektoren positiv, während andere hingegen „Kollateralschäden” erleiden. Auch dies ist eine Folge von schlechtem Management des technologischen Fortschritts.
Die Klimakrise ist vielleicht das offensichtlichste Beispiel dafür. Wir sehen es bei jedem extremen Wetterereignis, seien es Überschwemmungen, Dürren, Tsunamis oder Erdbeben: Wer leidet am meisten darunter? Es sind immer die Ärmsten. Sie verlieren das Wenige, das sie haben, wenn das Wasser ihre Häuser wegspült, und oft sind sie gezwungen, diese zu verlassen, ohne dass ihnen eine angemessene Alternative geboten wird, um ihr Leben wieder aufzubauen. Das Gleiche gilt beispielsweise für Bauern, Landwirte und indigene Völker, die aufgrund der Wüstenbildung in ihrem Gebiet ihr Land, ihre kulturelle Identität und die nachhaltige lokale Produktion verlieren.
Ein weiterer Aspekt der „Neuerungen“, der insbesondere marginalisierte Menschen betrifft, hat mit den Ängsten und Hoffnungen der Ärmsten angesichts der Lebensmodelle zu tun, die heute ständig propagiert werden. Wie kann beispielsweise ein junger Mensch in Armut hoffnungsvoll und ohne Ängste leben, wenn die sozialen Medien ständig einen zügellosen Konsum und einen völlig unerreichbaren wirtschaftlichen Erfolg verherrlichen?
Ein weiteres nicht zu vernachlässigendes Problem ist die Verbreitung der Abhängigkeit vom digitalen Glücksspiel. Die Plattformen sind so konzipiert, dass sie eine zwanghafte Sucht erzeugen und Gewohnheiten hervorrufen, die zu Abhängigkeit führen.
Ich möchte auch nicht die „Neuerung“ der Pharmaindustrie unerwähnt lassen, die zwar in mancher Hinsicht einen großen Fortschritt darstellt, aber nicht frei von Zweideutigkeiten ist. In der heutigen Kultur wird mit Hilfe bestimmter Werbekampagnen eine Art Kult um das körperliche Wohlbefinden propagiert, fast eine Vergötzung des Körpers, und durch diese Darstellung wird das Geheimnis des Leidens verkürzt interpretiert. Dies kann auch zu einer Abhängigkeit von Schmerzmitteln führen, deren Verkauf natürlich die Gewinne der Herstellerfirmen steigert. Diese Situation hat zu einer Opioidabhängigkeit geführt, die insbesondere die Vereinigten Staaten heimsucht; man denke beispielsweise an Fentanyl, die Droge des Todes, die zweithäufigste Todesursache unter den Armen in diesem Land. Die Verbreitung neuer, immer tödlicherer synthetischer Drogen ist nicht nur ein Verbrechen der Drogenhändler, sondern eine Realität, die mit der Medikamentenproduktion und ihrem gewinnorientierten System zu tun hat, denen es an globaler Ethik mangelt.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Entwicklung neuer Informations- und Telekommunikationstechnologien von Mineralien abhängt, die oft im Boden armer Länder zu finden sind. Ohne das Coltan aus der Demokratischen Republik Kongo beispielsweise gäbe es viele der technologischen Geräte, die wir heute nutzen, nicht. Seine Gewinnung ist jedoch mit paramilitärischer Gewalt, Kinderarbeit und Vertreibung der Bevölkerung verbunden. Lithium ist ein weiteres Beispiel: Der Wettbewerb zwischen Großmächten und Großunternehmen um dessen Gewinnung stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Souveränität und Stabilität armer Staaten dar, sodass einige Unternehmer und Politiker sich damit brüsten, Staatsstreiche und andere Formen der politischen Destabilisierung zu fördern, um sich das „weiße Gold” Lithium anzueignen.
Und schließlich möchte ich noch das Thema Sicherheit ansprechen. Staaten haben das Recht und die Pflicht, ihre Grenzen zu schützen, aber dies musss gegen die moralische Verpflichtung, Zuflucht zu gewähren, abgewogen werden. Bei den Übergriffen auf schutzbedürftige Migranten handelt es sich nicht um die legitime Ausübung nationaler Souveränität, sondern um schwere Verbrechen, die vom Staat begangen oder geduldet werden. Es werden immer unmenschlichere Maßnahmen ergriffen – die sogar politisch gefeiert werden –, um diese „Unerwünschten” wie Abfall und nicht wie Menschen zu behandeln. Das Christentum hingegen bezieht sich auf den Gott der Liebe, der uns alle zu Brüdern und Schwestern macht und uns auffordert, als solche zu leben.
Gleichzeitig macht es mir Mut zu sehen, wie Soziale Bewegungen, Organisationen der Zivilgesellschaft und die Kirche diesen neuen Formen der Entmenschlichung entgegen treten und immer wieder bezeugen, dass diejenigen, die in Not sind, unsere Nächsten, unsere Brüder und Schwestern sind. Das macht Euch zu Verfechtern der Menschlichkeit, zu Zeugen der Gerechtigkeit, zu Poeten der Solidarität.
Der gerechte Kampf der Sozialen Bewegungen
In Rerum novarum stellte Leo XIII. fest, dass „in der Umwälzung des vorigen Jahrhunderts die alten Genossenschaften der arbeitenden Klassen zerstört [wurden, aber] keine neuen Einrichtungen traten zum Ersatz ein ”. [10] Die Armen sind zunehmend verwundbar und schutzlos. Heute ist etwas Ähnliches zu beobachten, denn die für das 20. Jahrhundert charakteristischen Gewerkschaften vertreten derzeit einen immer geringeren Prozentsatz der Arbeitnehmer, und die Sozialversicherungssysteme in vielen Ländern stecken in einer Krise. Daher scheinen weder Gewerkschaften noch Arbeitgeberverbände, Staaten oder internationale Organisationen in der Lage zu sein, diese Probleme anzugehen. Aber „ein Staat ohne Gerechtigkeit ist kein Staat“, erinnert uns der heilige Augustinus. [11] Gerechtigkeit verlangt, dass die Institutionen jedes Staates allen sozialen Schichten wie der gesamten Bevölkerung zu dienen und die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen in Einklang zu bringen haben. Wieder einmal stehen wir vor einem ethischen Vakuum, in das das Böse leicht eindringen kann. Mir fällt das Gleichnis vom unreinen Geist ein, der ausgetrieben wird, aber bei seiner Rückkehr seine alte Behausung sauber und ordentlich vorfindet und dann einen noch schlimmeren Kampf organisiert (vgl. Mt 12,43-45). In dem geordneten Vakuum kann der böse Geist frei wirken. Die sozialen Institutionen der Vergangenheit waren nicht perfekt, aber indem ein Großteil von ihnen abgeschafft und das, was übrig bleibt, mit unwirksamen Gesetzen und nicht umgesetzten Verträgen verziert wird, macht das System die Menschen verletzlicher als zuvor.
Deshalb sind Soziale Bewegungen zusammen mit Menschen guten Willens, Christen, Gläubigen und Regierungen dringend aufgefordert, diese Lücke zu füllen, indem sie Prozesse der Gerechtigkeit und Solidarität in Gang setzen, die sich in der gesamten Gesellschaft ausbreiten, denn, wie ich bereits gesagt habe: „Illusionen lenken uns ab, Vorbereitungen geben uns Orientierung. Illusionen streben nach einem Ergebnis, Vorbereitungen ermöglichen eine Begegnung”. [12]
Im Apostolischen Schreiben Dilexi te habe ich daran erinnert, dass „verschiedene Volksbewegungen, die aus Laien bestehen und von volksnahen Führungspersönlichkeiten geleitet werden […], oft verdächtigt, ja verfolgt werden“. [13] Eure Kämpfe unter dem Banner von Land, Wohnung und Arbeit für eine bessere Welt verdienen jedoch unsere Unterstützung. So wie die Kirche in der Vergangenheit die Gründung von Gewerkschaften begleitet hat, müssen wir heute die Sozialen Bewegungen begleiten. Das bedeutet, die Menschheit zu begleiten, gemeinsam im gegenseitigen Respekt vor der Menschenwürde und im gemeinsamen Wunsch nach Gerechtigkeit, Liebe und Frieden zu gehen.
Die Kirche unterstützt Eure gerechten Kämpfe für Land, Wohnung und Arbeit. Wie mein Vorgänger Franziskus glaube ich, dass die richtigen Wege von unten und von der Peripherie zum Zentrum führen. Eure zahlreichen kreativen Initiativen können zu neuen politischen Maßnahmen und sozialen Rechte führen. Euer Streben ist legitim und notwendig.
Wer weiß, ob die Samen der Liebe, die Ihr sät, klein wie Senfkörner (vgl. Mt 13,31-32; Mk 4,30-32; Lk 13,18-19), zu einer menschlicheren Welt für alle heranwachsen und dazu beitragen können, die „neuen Dinge” besser zu bewältigen. Die Kirche und ich möchten Euch auf diesem Weg begleiten. Wir erheben weiterhin unsere Gebete zum allmächtigen Gott.
Gemeinsam mit Euch bitten wir den Vater aller Barmherzigkeit im Gebet, Euch zu beschützen und mit seiner unerschöpflichen Liebe zu erfüllen. Möge er Euch in seiner unendlichen Güte den Mut zu einer evangeliumsgemäßen Prophetie, die Ausdauer im Kampf, Hoffnung im Herzen und poetische Kreativität schenken.
Ich vertraue Euch der mütterlichen Führung der Heiligen Maria an. Und aus tiefstem Herzen segne ich euch.
Danke, danke Euch allen! Und geht weiter auf diesem Weg, mit Freude und Hoffnung! Danke. Dann lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus es uns gelehrt hat.
[1] „Tierra, techo, trabajo”, die drei „T” auf Spanisch.
[2] Franziskus, Videobotschaft, 16. Oktober 2021.
[3] Videobotschaft anlässlich der Vorstellung des Projekts „Gesti dell’accoglienza” (Gesten der Aufnahme) in Lampedusa für die Aufnahme in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO, 12. September 2025.
[4] Franziskus, Enzyklika Laudato si’, 49.
[5] Ebenda, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 202.
[6] Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veritate, 42.
[7] Vgl. Augustinus, Rede 259, 3.
[8] Leo XIII., Enzyklika Rerum novarum, 3.
[9] Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 53.
[10] Leo XIII., Enzyklika Rerum novarum, 3.
[11] Augustinus, De civitate Dei, XIX, 21, 1.
[12] Leo XIV., Generalaudienz, 6. August 2025.
[13] Leo XIV., Apostolisches Schreiben Dilexi te, 80.