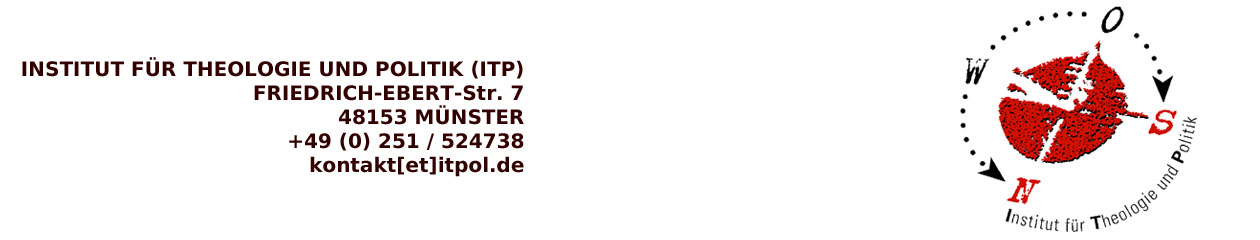Eine Rezension von Prof. em. Dr. Norbert Mette, Juli 2025
Am 10. Juni wurde in Lima (Peru) vom Centro de Estudios y Publicaciones (CEP) und Instituto Bartolomé de Las Casas ein gerade neu erschienenes von Gustavo Gutiérrez vorgestellt: Vivir y pensar el Dios de los pobres. Es handelt sich um das Buch, an dem Gutiérrez seit 2000 gearbeitet hat und das er bis zu seinem Tod am 22. Oktober 2024 nicht mehr selbst hat abschließen können. Diese Aufgabe hat Leo Guardado übernommen.
Er hat in seinem Studium an der University of Notre Dame (Indiana, USA) an Seminaren von Gustavo Gutiérrez teilgenommen und hielt seitdem engen Kontakt zu ihm. Aktuell ist er Assisstent Professor of Systematic Theology an der Fordham University in New York. Ende 2021 hat Gutiérrez ihm die Verantwortung für den Abschluss des Buches anvertraut. Der Großteil des Manuskripts, so teilt Guardado mit, sei abgeschlossen gewesen. Wo das nicht der Fall gewesen sei, besonders im Kapitel 12, habe er auf frühere Publikationen vom Gutiérrez zurückgegriffen und das in den Fußnoten angegeben. Guardado betont: „Eine klare Regel der Edition bestand darin, dass das gesamte Buch den Texten und den Worten von Gustavo entspricht.“ (43) Die Fußnoten hatten allerdings noch sorgfältig aufbereitet werden müssen. Der so entstandene Anmerkungsapparat ist neben Verweisen auf Schriften von Gutiérrez und sachlichen Erläuterungen ein Fundort für Hinweise auf Literatur zum Forschungsstand der verschiedenen behandelten Themen.
Papst Franziskus hat zu dem Buch ein Vorwort beigesteuert (11-18); er hat es knapp einen Monat vor seinem Tod (21. April 2025) am 24. März 2025 (Gedenktag an den Hl. Óscar Arnulfo Romero) unterschrieben. Er bringt darin seine hohe Wertschätzung der Person und dem Werk von Gustavo Gutiérrez gegenüber zum Ausdruck. Ein Zitat daraus: „Die Theologie von Gustavo Gutíérrenz bleibt in der Kirche nicht als ein schöner Schatz aus der Vergangenheit erhalten, sondern als dieser `zweite Akt`, eine immer noch bestehende Aufgabe, über unsere gelebte Gotteserfahrung nachzudenken; eine Erfahrung, die bereits begonnen und erprobt wurde, genau dort, wo wir die Nächsten der Verwundeten, der am Straßenrand Ausgeraubten wurden und von wo aus wir versuchen, demütig und voller Überzeugung zu den Ärmsten und zu allen zu sagen: `Gott liebt dich.` Gustavo hat uns die nötigen theologischen Werkzeuge gegeben, damit wir niemals die Armen vergessen.“ (15f; Zitate aus dem Buch sind jeweils eigene Übersetzungen, NM)
Das Buch umfasst 498 Seiten. Gegliedert ist es in vier Teile mit insgesamt 14 Kapiteln; eingerahmt in Einleitung und Zusammenfassung. Im Anhang sind eine Biographie und eine Liste der Bücher von Gustavo Gutiérrez beigefügt.
Dem Text von Gutiérrez ist ein ausführliches Vorwort des Herausgebers vorangestellt (21-42). Darin rekonstruiert er den theologischen Denkweg von Gutiérrez anhand der von ihm veröffentlichten Bücher, beginnend mit der „Theologie der Befreiung“ (1971) bis hin zur Aufsatzsammlung „De Medellin a Aparecida“ (2018), um dann auf sein nunmehr posthum erschienenes Buch einführend einzugehen. Es macht nach ihm die auf die gegenwärtigen Herausforderungen hin aktualisierte Summe seines theologischen Denkens aus, wobei für Gutiérrez, wie er in dem Buch immer wieder betont, Theologie und Spiritualität eine Einheit bilden.
Im Einleitungskapitel umreißt Gutiérrez das Format, wie eine Theologie zu betreiben ist, die dem Gedenken Gottes gerecht wird (Hacer nuestra la memoria de Dios) Programmatisch macht das der erste Satz deutlich: „Die Heilige Schrift sagt uns, dass das Antlitz des Armen uns anfragt und dass darin der Gott die Liebe wirkt, wie es uns Jesus von Nazaret verkündet hat.“ (47) Die Bibel und die Armen bilden somit die Ausgangspunkte für die theologische Reflexion.“Gottes besonderes Gedenken an die Unterdrückten und Ausgegrenzten ist ein Kriterium der Urteilsbildung und des Engagements angesichts der Tatsachen, die das Leben nach dem Evangelium ernsthaft vor Herausforderungen stellen. Dies zu ergründen, ist die Absicht dieses Essays.“ (49)
Der erste Teil des Buches handelt über die Zeichen der Zeit (Los signos de los tiempos). Im Mittelpunkt steht die Tatsache der Armut, von der ein Großteil der Bevölkerung auf der südlichen Hemisphäre – Gutiérrez bezieht sich besonders auf Lateinamerika und die Karibik – betroffen ist. Eigens erwähnt dabei Gutiérrez die Frauen als besonders hart von der Armut betroffene. Unter Rückgriff auf einschlägige sozialwissenschaftliche Studien beleuchtet er die Armut in ihren verschiedenen Aspekten. Ein Zitat: „Die Armut ist eine historische Tatsache, menschlichen Ursprungs, Resultat, wie das soziale Leben in seinen Strukturen und mentalen Kategorien organisiert wird. Die soziale Bedeutungslosigkeit ist kein Schicksal, sondern ein Zustand, kein Unglück, sondern eine Ungerechtigkeit. Sie ist ein Produkt überkommener sozialer Auffassungen und Verhaltensweisen wie rassistischer, kultureller, sexistischer und religiöser Vorurteile, wie sie sich im Laufe der Geschichte zusammen mit immer ehrgeizigeren ökonomischen Interessen angehäuft haben. Die Abschaffung der Armut liegt in den Händen von Menschen. Sie ist kein Schicksal. Wir sind verantwortlich für sie, speziell die, die im der Gesellschaft mehr Macht und Privilegien innehaben.“ (97f) Als bedeutsam gilt es in diesem Zusammenhang für Gutiérrez, dass es die Armen selbst sind, die zu aktiven Subjekten in der Welt geworden sind („irrupción del pobre“). Das ist auch, wie Gutiérrez im Einzelnen aufzeigt, zu einer Anfrage an das theologische Denken und das kirchliche Handeln geworden. Im Reich Gotts, wie Jesus es verkündet hat, komme den Armen eine besondere Bedeutung zu. In neueren kirchlichen Dokumenten spiegele sich das wieder, besonders in der lehramtlich getroffenen vorrangigen Option für die Armen. Aber, so betont Gutiérrez am Schluss dieses ersten Teils, darin stecke eine Aufgabe, die komplex und immer wieder neu anzugehen sei – „in Barmherzigkeit und Demut, in Liebe und Gerechtigkeit, im Gebet und in der Hoffnung auf einen Gott des Lebens“ (173).
„Das Antlitz Jesu wiedererkennen“ (Reconocer el rostro Jesu) lautet der Titel des zweiten Teils. In den einzelnen Kapiteln geht es Gutiérrez darum, vor allem die biblischen Grundlagen für die Option für die Armen zusammenzustellen. Angesichts des in seiner Schöpfung grundgelegten Geschenks des Lebens erweist sich die Armut als Negation des Lebens und der Gerechtigkeit. Jesu Botschaft vom Reich Gottes sei zentral auf die Befreiung dieses Geschenks ausgerichtet. Von daher sieht Gutiérrez die Aufgabe der Theologie darin, die Geschichte im Unterschied zu deren vorherrschenden Betrachtungsweise als „Geschichte des Anderen“ im Sinne von Walter Benjamin zu lesen. Die sich daraus ergebende asymmetrische Ethik mit dem Primat des Anderen (Emmanuel Levinas) zeichnet er anhand des dafür beispielhaft vorliegenden Gleichnisses vom barmherzigen Samariter nach. In der in der Exegese geführten Auseinandersetzung, ob das Gleichnis vom Gericht des Menschensohnes (Mt 25, 31-46) sich im engeren Sinne auf die Glaubensgeschwister beziehe oder universal ausgerichtet sei, spricht sich Gutiérrez mit Blick auf den biblischen Kontext für die zweite Alternative aus: In den hungrigen, durstigen, fremden, nackten und gefangenen Menschen begegnet uns Jesus. Daraus ergibt sich für ihn praktisch: „Das, was Matthäus als Gesten der Solidarität mit den Ausgegrenzten und Misshandelten darlegt, muss in unserer Zeit in Übereinstimmung mit der aktuellen Realität, deren Umstände und unserer Sichteise der Armut und ihrer Ursachen gelebt werden. Das bedeutet, mit allem, was das impliziert, heute eine gerechte und menschliche Gesellschaft errichten. Dabei ist mit Konflikten zu rechnen, die sich beispielsweise ergeben einerseits aus der Verurteilung, die die fürchterliche Gewalt der Armut und die Vernachlässigung der Sektoren, in denen die Ärmsten und Marginalisiertesten unserer Gesellschaft leben, verdienen, und andererseits aus der Feindseligkeit und der Irreführung, die von gewissen sozial privilegierten Kreisen unserer Länder ausgehen, wenn man sie auf die Ursachen dessen hinweist. Über politische und ideologische Differenzen hinweg stehen das Schicksal und das Leiden derer, die Jesus als `die Geringsten meiner Schwestern und Brüder´ bezeichnet, auf dem Spiel und die Verpflichtung, die sich daraus ergibt.“ (290f)
Der dritte Teil handelt von der „dreifachen Dimension der Option für die Armen“ (La triple dimensión de la opción por el pobre). Sie besteht Gutiérrez zufolge in der Nachfolge Jesu, der Theologie in einem bestimmten Verständnis und der praktischen Verkündigung des Evangeliums. Auch in diesem Teil bezieht er sich auf die biblische Tradition als entscheidendem Referenzpunkt. Nachfolge Jesu macht für ihn einen Stil des Lebens im Ganzen aus und sei somit gleichbedeutend mit Spiritualität, wenn diese nicht als auf einen Teilbereich des Lebens, die private Innerlichkeit reduziert verstanden wird. Ihre wesentlichen Vollzüge bestehen in der Annahme des Geschenks des Lebens und im Teilen dessen mit anderen, besonders mit den Armen und Leidenden. Die Theologie besteht nach Gutiérrez in der Einheit von Wissenschaft und Weisheit. Damit wohnt auch ihr wesentlich eine spirituelle Dimension inne, eine Vision der Welt und der Gesellschaft, eine Weise zu leben. Die biblischen Quellen, aus der die Option für die Armen erwachsen ist, besagen für die Verkündigung, dass sie vorrangig in zwei Sprachen zu erfolgen hat, der Sprache der Gerechtigkeit und der Sprache der Gratuität. Im Schlusskapitel dieses Teils führt Gutiérrez aus, was sich aus diesen Überlegungen für die Praxis der Nachfolge ergibt.
In den Mittelpunkt dieses Teils steht ein Begriff, der für das Leben und Überleben der armen Völker eine zentrale Rolle spielt und dem auch in der Bibel große Bedeutung zukommt: Hoffnung. Gutiérrez entwickelt daraus eine „Hermeneutik der Hoffnung“. Im folgenden Zitat findet sich dazu eine dichte Zusammenfassung: „Das Geschenk der Hoffnung anzunehmen, öffnet für die Zukunft. Die Theologie, als Reflexion über die Liebe Gottes und Hermeneutik der Hoffnung, erfüllt eine befreiende Funktion. Sie wendet sich gegen die Lähmung, die bestimmte Situationen hervorrufen, und weigert sich, sich den Fakten zu unterwerfen. Die Theologie, als reflektierte Hoffnung verstanden, wird anspruchsvoller, wenn sie an der Situation der Armen und der Solidarität mit ihnen Anteil nimmt. Es ist keine einfache Hoffnung, aber trotz ihrer scheinbaren Fragilität kann sie in der Welt der sozialen Bedeutungslosigkeit, in der Welt der Armen Wurzeln schlagen und selbst inmitten schwieriger Rahmenbedingungen etwas zum Zünden bringen und lebendig und kreativ bleiben. Hoffnung ist kein passives Warten, sie muss sich dafür einsetzen, auf unserem Weg aktiv Gründe für die Hoffnung zu ersinnen. Wir möchten klarstellen, dass die Hoffnung auf Gottes Liebe streng genommen eine Lebenshaltung ist, die nicht mit einer historischen Utopie oder einem sozialen Projekt zu verwechseln ist. Doch sie setzt diese voraus, erzeugt und erfordert sie in dem Maße, wie sie konkrete Wege ermitteln, um den Willen zum Aufbau einer gerechten und geschwisterlichen Gesellschaft zu erfüllen. Die Theologie entsteht an der Schnittstelle (intersección) zwischen `einem Raum der Erfahrung´ und `einem Raum der Hoffnung´. Einem Raum, in dem Jesus uns einlädt, ihm in der Erfahrung der Begegnung mit dem anderen, speziell den Geringsten seiner Schwestern und Brüder zu folgen. Und mit der Hoffnung, dass diese Begegnung offen ist für alle, Gläubige und Ungläubige, begeben wir uns in den Horizont des Dienstes am anderen und an der Gemeinschaft mit dem Herrn.“ (357f)
Es folgt der vierte Teil mit der Überschrift „Die großen Herausforderungen, die frohe Botschaft vorzuschlagen“ (Los grandes retos a la propuesta de la buena nueva). Im Einzelnen werden von Gutiérrez drei Herausforderungen aufgegriffen: die Debatte um die Moderne und/oder Postmoderne, die aktuelle Lage und Komplexität der (inhumanen) Armut in der Welt und die Pluralität der Religionen. Diese drei Herausforderungen, so betont er, seien voneinander unabhängig zu sehen und zu analysieren, griffen aber doch gerade unter den Bedingungen der Globalisierung ineinander über. Ohne auf sie so detailliert eingehen zu können, wie es Gutiérrez in den drei Kapiteln dieses Teils tun, sei festgehalten, dass er den Akzent darauf legt, was diese Herausforderungen für die Theologie und für die Art, das Evangelium zu leben und zu verkündigen, bedeutet, und dass dieser Akzent von ihm nochmals zugspitzt wird auf die Frage, ob und wie das Ganze sich in den Augen der Armen in der Welt darstellt. Um das an einem Beispiel kurz anzudeuten: Gutiérrez macht klar, dass der in Gang gekommene Dialog zwischen den Religionen sich bisher auf der Ebene der sog. Weltreligionen abspielt und die Religionen z.B. die Kosmovisionen der indigenen Völker oder die religiös-spirituellen Elemente im Leben der Armen ausgeklammert bleiben – und damit ebenso zur Bedeutungslosigkeit verurteilt sind wie die, die aus ihren Quellen leben.
Abschließend bemerkt Gutiérrez zur Agenda der Theologie: „Das Reich Gottes verwirklicht sich in immer neuen Formen in der Geschichte. Um in den Dialog mit anderen Realitäten einzutreten, ist eine große Freiheit des Geistes erforderlich. Dieser verhilft dazu, nicht die Mittel mit dem Zweck zu verwechseln und nicht subtilen Idolatrien zu verfallen. Wir stehen vor einer anregenden und viel versprechenden Aufgabe, für die die Theologie der Befreiung, die heute noch in ihren Anfängen steckt, viel zu tun und vor allem viel zu lernen hat. Dieses alles, wenn man die Überzeugung teilt, dass diese Theologie, solange sie dem Evangelium und der Sache der Armen (was die Sache des Gottes Jesu ist) dient, ein Wort zu sagen hat. Wenn aus verschiedenen und heute unvorhersehbaren Umständen dieser Dienst sich erschöpft hat oder nicht mehr nötig ist, wird sie sich darauf verstehen müssen zu schweigen. Dieses Schweigen wird vermutlich auf irgendeine Weise der Beginn sein, dass in verschiedenen Ausdrucksweisen die Stimme der Armen und Unterdrückten von heute mehr und besser gehört wird. Die Theologie der Befreiung wird in diesem Moment ihre Akzente auf Themen setzen, die dauerhaft zu dem Erbe der christlichen Botschaft gehören. Auf sehr spezielle Weise ist es die Option für die Armen, an die sie erinnern konnte; aber sie muss zweifellos auf eine Weise auf neuen Wegen erforscht werden. Welchen anderen Sinn kann, wenn überhaupt, eine bestimmte Theologie haben?“ (489f)
Eine Frage, von der sich auch das Theologietreiben in anderen Kontexten angesprochen fühlen könnte …